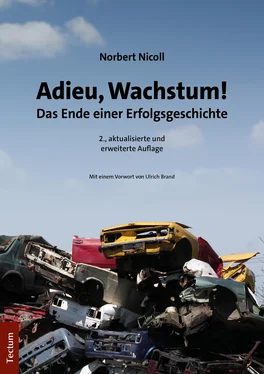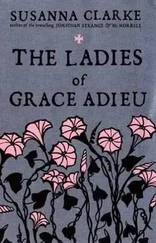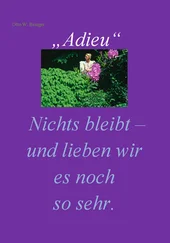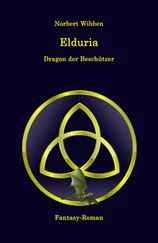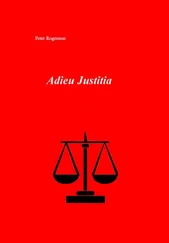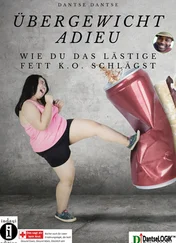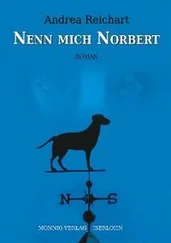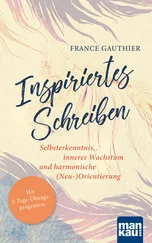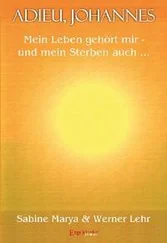7Grundlage dieser These sind die Zahlen des Global Footprint Networks aus dem Jahr 2019. Mehr dazu im 24. Kapitel dieses Buches.
8Vgl. Jackson, Tim: Wohlstand ohne Wachstum. Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 1280, Bonn 2012, S. 29.
9Vgl. Michaux, Simon: Oil from a Critical Raw Material Perspective, Geological Survey of Finland, GTK Open File Work Report, Espoo 2019, S. 17. Online unter: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/70_2019.pdf[Stand: 27.1.2021].
10Der Autor ist Politikwissenschaftler und Ökonom, kein Umweltwissenschaftler, kein Klimatologe, kein Physiker, kein Geologe. Und kein Heiliger. Er fährt Auto und tut jede Menge andere Dinge, die der Umwelt Schaden zufügen. Und wie viele andere fragt er sich, warum echte Verhaltensänderungen so schwierig sind.
PROBLEMAUFRISS
»Wir befinden uns zwar auf dem falschen Gleis, gleichen dieses Manko aber durch höhere Geschwindigkeit aus.«
Stanislaw Jerzy Lec, polnischer Satiriker und Aphoristiker
2. Mittendrin in der Vielfachkrise
Wir befinden uns an der Abbruchkante der Geschichte. Die Situation des Planeten ist gekennzeichnet durch das Zusammentreffen von drei Krisen, die schon bald ihre Latenzphase verlassen und noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts offen ausbrechen werden.
Zu nennen sind:
• die Klimakrise
• die Energiekrise
• die Ressourcenkrise (Übernutzung und Erschöpfung natürlicher Ressourcen)
Die tieferen Ursachen für diese schwerwiegenden Langzeitentwicklungen, die manchmal auch unter dem Terminus Biokrise zusammengefasst werden, sind:
• die dominanten Wirtschaftsparadigmen (Wirtschaftswachstum, Gewinnmaximierung der Unternehmen, individuelle Reichtumsvermehrung)
• die hemmungslose Nutzung fossiler Brennstoffe
• die globale Verbreitung des westlichen, am Haben 11orientierten Konsummodells (Konsumismus)
• die willkürliche und bewusste Zerstörung von nachhaltigen Kulturen und Lebensformen
• das Ignorieren natürlicher Grenzen des Planeten, was u. a. die Ressourcenverfügbarkeit und die Regenerationskapazitäten der Erde anbelangt
• Bevölkerungsdruck
Die öffentliche Debatte um jegliche Umwelt- und Ressourcenprobleme wird dominiert vom Klimawandel. Dieser ist in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen, die Schlagseite der Berichterstattung ist jedoch problematisch. Was fehlt, ist eine ganzheitliche Betrachtung. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Dinge zusammenzudenken.
In Zusammenhängen denken
Tatsächlich gibt es jenseits der Klimakrise weitere gefährliche Entwicklungen:
• In der Ökonomie türmen sich die Probleme aufeinander, die die Coronakrise weiter verschärft hat. Private wie öffentliche Schulden sind massiv angewachsen – ebenso wie die Armut. Neue Spekulationsblasen entstehen vor unseren Augen und weitere wirtschaftliche Einbrüche werden kommen. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann und in welcher Heftigkeit.
• In der Sphäre der Politik ist mindestens eine Legitimationskrise der Herrschenden zu beobachten, nach Ansicht vieler Politikwissenschaftler sogar eine Krise des politischen Systems insgesamt. Alarmzeichen gibt es viele: Die Bürger- und Menschenrechte werden im Zuge des sogenannten »Krieges gegen den Terror« beschnitten, während der Überwachungsstaat vielerorts aufgebaut wurde. Der Lobbyismus wuchert wie noch nie, und die Medien, eigentlich die vierte Gewalt, betreiben immer weniger aufklärerische Arbeit, dafür umso mehr Verlautbarungsjournalismus. Gleichzeitig sinkt in vielen Ländern Europas das Interesse der Menschen an Politik. Nicht von ungefähr entwickeln sich die Wahlbeteiligungen europaweit rückläufig. Sehr viele Menschen fühlen sich schlicht nicht mehr vertreten. Manche Beobachter konstatieren, die Demokratie stehe am »Rand ihrer Existenz« 12.
• Politologen wie Colin Crouch sehen die Phase der Postdemokratie 13gekommen. Die Institutionen der parlamentarischen Demokratie – Wahlkämpfe, periodisch abgehaltene Wahlen, Parteienkonkurrenz, Gewaltenteilung – sind formal gesehen völlig intakt. Aber in Wirklichkeit sind sie, entkernt und ausgehöhlt, auf den Charakter von Fassaden reduziert.
• In vielen europäischen Ländern wächst die Ungleichheit. Speziell die Einkommensungleichheit hat sehr stark zugenommen. 14Die Unterschiede zwischen dem gesellschaftlichen Oben und Unten vergrößern sich. Die Kapitaleinkommen verzeichneten in den letzten 40 Jahren ein beeindruckendes Wachstum, während die Arbeitseinkommen stagnierten oder real sanken. Die Spaltung der Gesellschaft vertieft sich. Die Mittelschicht erodiert, prekäre Beschäftigungsformen breiten sich aus. Die meisten Gemeinschaften in den westlichen Gesellschaften sind heute sozial schwächer als vor 20 oder 30 Jahren. Wir durchleben eine »soziale Rezession«, die durch eine schwächere Teilnahme am öffentlichen Leben und einen rückläufigen Gemeinschaftssinn gekennzeichnet ist. 15
• In vielen Regionen der Erde leiden unerträglich viele Menschen Hunger. 37.000 Menschen sterben jeden Tag an den direkten oder indirekten Folgen des Hungers. Das ist ein Skandal. Laut Angaben eines UN-Berichts aus dem Jahr 2019 hungern 821 Millionen Menschen weltweit – und damit 36 Millionen Menschen mehr als 2015. 16Hunger ist immer noch ein Verteilungsproblem, der Planet kann gegenwärtig mehr als genug Nahrung bereitstellen. Im reichen Westen werden enorme Lebensmittelmengen verschwendet. 17Die Ursachen des Hungers sind durchaus vielfältig. Das Problem vieler Hungernder liegt heute darin, dass ihnen das Geld fehlt, um Nahrungsmittel zu kaufen, bzw. dass sie kein Land haben, um auf diesem Nahrung anbauen zu können. Drei Milliarden Menschen leben von weniger als 2,50 US-Dollar pro Tag. 18
Mit Fug und Recht kann man also von einer multiplen Krise sprechen. 19Der Begriff erscheint deshalb angemessen, weil er nicht suggeriert, dass es sich bei den gerade in sehr groben Zügen beschriebenen Entwicklungen um eine Addition unterschiedlicher und weitgehend unabhängiger Krisenerscheinungen handelt. Das Gegenteil ist der Fall: Die genannten Entwicklungen existieren nicht zusammenhanglos nebeneinander, sondern sind kausal miteinander verknüpft.
Wo liegt die Verknüpfung? Der Zusammenhang besteht, vereinfacht ausgedrückt, in der fossilistisch-kapitalistischen Lebens- und Produktionsweise, die seit den späten 1970er Jahren nach den Ideen des Neoliberalismus 20umgebaut wurde. Das Produktions- und Konsummodell des gegenwärtigen Kapitalismus trägt die Mutter aller Krisen im Herzen. Es verlangt hohe Zuwachsraten der Produktivität, ist auf Massenproduktion und Massenkonsum ausgelegt und daher auch auf massenhaften Verbrauch von Rohstoffen und Landflächen sowie von fossiler Energie. 21Die verblichenen realsozialistischen Systeme waren in dieser Hinsicht keinesfalls besser, 22doch ein wirklicher Trost ist das nicht.
Richtige und falsche Prognosen
Schon auf diesen ersten Seiten war sehr oft von Krisen die Rede. Der Begriff der Krise ist interessant und gehört thematisiert. Die Medien betiteln schnell alles Mögliche als Krise. Fast jeden Tag berichten die Zeitungen, Radiostationen und Fernsehsender von einer neuen Krise. Der inflationäre Gebrauch des Krisenbegriffs hat dazu geführt, dass er die meisten Menschen nicht mehr schrecken kann. Die wirklichen Probleme sind von den eingebildeten kaum noch zu unterscheiden.
Der Begriff der Krise suggeriert, dass ein temporärer Ungleichgewichtszustand vorliegt, der in einem absehbaren Zeitraum (einige Monate, höchstens wenige Jahre) beseitigt werden kann. Krisen sollen überwunden, gelöst oder bekämpft werden, so lauten in diesem Zusammenhang die Parolen. Manche Beobachter, wie zum Beispiel der Sozialpsychologe Harald Welzer, lehnen den Krisenbegriff als gänzlich untauglich ab, weil langfristige Probleme nicht kurz- und mittelfristig zu lösen seien. Welzer spricht lieber von »Funktionsgrenzen«.
Читать дальше