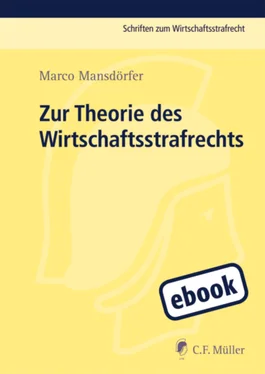aa) Gefährdungstatbestände als Tatbestände zur Durchsetzung der demokratisch festgelegten Allokation von Risiken in konkreten Erfahrungsräumen
154
Zur näheren Untersuchung der Gefährdungsdelikte ist die Unterscheidung zwischen abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikten geläufig. Im Schrifttum wird zum Teil innerhalb der abstrakten Gefährdungsdelikte deskriptiv zwischen konkreten Gefährlichkeitsdelikten, Eignungsdelikten, Kumulationsdelikten, Vorbereitungsdelikten und rechtsgutslosen Delikten differenziert[340] und versucht, für jede Deliktsgruppe die maßgebenden Legitimationskriterien zu spezifizieren[341]. Eine trennscharfe Abgrenzung zwischen den einzelnen neuen Deliktstypen ist bislang aber nicht gelungen und auch das kritische Potential ist für die hier im Vordergrund stehende Diskussion individueller Handlungssteuerung gering.
155
Zieschang weist in seiner Untersuchung der Gefährdungsdelikte auf das Problem hin, dass einige Gefährdungsdelikte so weit gefasst sind, dass sie im Einzelfall auch bloße Verstöße gegen Form- und Ordnungsvorschriften erfassen[342]. So pönalisiert etwa das Unerlaubte Betreiben von Anlagen im Sinne von § 327 Abs. 2 StGB im Grunde die Nichteinhaltung behördlicher Genehmigungsverfahren ohne Rücksicht auf aus einem Verstoß gegen diese Pflichten resultierende echte Gefahren für die Umwelt[343]. In ähnlicher Weise pönalisiert § 283 Abs 1 Nr. 7b StGB die Nichteinhaltung handelsrechtlicher Bilanzvorschriften, ohne dass sich dadurch die Position der Gläubiger tatsächlich verschlechtern muss[344]. Mit Blick auf die oben angedeuteten verschiedenen kommunikativen Gehalte der Strafe sind solche Straftaten bedenklich. De lege ferenda wäre es vorzugswürdig, solche Verhaltensweisen nicht als Straftaten, sondern als Ordnungswidrigkeiten zu bestrafen, und sich wieder vermehrt der Technik der sog. unechten Mischtatbestände zu bedienen[345]. Beispielhaft kann insoweit auf § 2 WiStG verwiesen werden: Danach sind Straftaten gem. § 1 WiStG als Ordnungswidrigkeiten zu behandeln, wenn die Tat ihrem Umfang und ihrer Auswirkung nach nicht geeignet ist, die Verwirklichung der Ziele, denen die in § 1 WiStG genannten Rechtsvorschriften zu dienen bestimmt sind, merkbar zu beeinträchtigen[346].
156
Kindhäuser sieht – zum Teil im Anschluss an Binding [347] – das Wesen des Gefährdungsdelikts im Schutz von Vertrauen und Sicherheit[348]. Dabei sind Vertrauen und Sicherheit insoweit austauschbar, als der Begriff des Vertrauens den psychologischen Reflex auf ein objektives Datum der Sicherheit darstellt. Die psychologisierende Betrachtung führt also insoweit in die falsche Richtung, als damit, soweit eine positive Verletzung des Rechtsgutes beschrieben werden soll, der grundlegende Unterschied zwischen Verletzung und Gefährdung aufgegeben wird. Kindhäuser geht daher einen richtigen und entscheidenden Schritt weiter und untersucht die Bedeutung von Sicherheit im Rahmen sozialer Interaktion: Die von den Gefährdungsdelikten geschützte Sicherheit ist danach dann gefährdet, wenn ein Verhalten die durch die Gesellschaft festgelegte Verteilungsordnung von Risiken verletzt[349]. Gefährdungsdelikte dienen also dazu, die demokratisch festgelegte Allokation von Risiken strafrechtlich durchsetzen zu können.
157
Zu diesem Zweck stellen Gefährdungsdelikte im Gegensatz zu den allgemeinen Verletzungsdelikten auf einen konkreten Erfahrungsraum ab[350]. Sie sind auf spezifische Ereignisse fokussiert und berücksichtigen deren zeitlichen, örtlichen und sozialen Kontext.
Beispiele für Erfahrungsräume:
Die Gefahr des Todes oder einer lebensgefährlichen Gesundheitsschädigung, wenn jemand in hilfloser Lage ausgesetzt oder im Stich gelassen wird; die Gefahr einer erheblichen Störung des individuellen Rechtsfriedens, wenn eine Person mit der Begehung eines Verbrechens bedroht wird; Gefahren durch große Brände oder Umweltverschmutzungen, die geeignet sind, die menschliche Gesundheit zu schädigen; der Umgang mit gefährlichen Stoffen und das Verhalten in für eine moderne Industriegesellschaft notwendigen Institutionen, wie etwa in einem funktionierenden Waren-, Kapital- oder Arbeitsmarkt.
Der Gesetzgeber kann und muss dem Einzelnen hier genau sagen, welche Pflichten er zu erfüllen und welche Handlungen er zu unterlassen hat[351]. Jakobs gelangt daher zu dem Schluss, die Normen der abstrakten Gefährdungsdelikte hätten oft die Funktion, die Normgeltung von Verletzungsverboten flankierend zu sichern und die Abweichung von Standards zu sanktionieren[352]. Das Gefährdungsdelikt ist damit die typische Deliktsform des Nebenstrafrechts.
158
Der Strafgrund des Gefährdungsdelikts liegt in der Vornahme einer (straf)rechtlich missbilligten Handlung, der ein typisches Gefährdungspotential immanent ist[353]. Das Verbot betrifft einzelne Handlungen oder auch nur einzelne Handlungsweisen, denen rechtlich nicht tolerierte Verletzungsrisiken innewohnen[354]. Der Einzelne muss demnach Sorge tragen, dass er diese Verhaltensweisen nicht an den Tag legt, da ihm insoweit kein äußerer Freiraum zusteht[355].
bb) Grundsätzliche Legitimität von Gefährdungsdelikten
159
Kritisch wird gegenüber den Gefährdungsdelikten vorgebracht, sie würden mit ihrer Vorverlagerung der Strafbarkeit in das Vorfeld von materiellen Rechtsgutsverletzungen die Handlungsfreiheiten anderer übermäßig einschränken und zu einer ungerechtfertigten Expansion des Strafrechts führen[356]. Die Prämisse dieser Kritik, Gefährdungsdelikte würden die Handlungsfreiheiten der Normadressaten übermäßig einschränken, trifft so freilich nicht zu. Indem sich die Gefährdungsdelikte auf einen konkreten Erfahrungsraum beziehen, betreffen sie gerade nicht die allgemeine Handlungsfreiheit der Normadressaten in der abstrakten Form, grundsätzlich alles zu tun oder unterlassen zu können. Sie wenden sich vielmehr an Personen in einer konkreten Handlungssituation und an Personen, die sich entschieden haben, ihre Handlungsfreiheit in einer ganz bestimmten Richtung auszuüben. Besonders gefährliche Tätigkeiten wird der Gesetzgeber dabei a priori Personen mit einer adäquaten Ausbildung zuweisen. Beispielhaft ist das Verlangen von Qualifikationsnachweisen, wie dem der Eignung zum Führen großer Fahrzeuge, zur Beförderung von Personen im Verkehr, zum Transport gefährlicher Güter, zum Handel mit gefährlichen Stoffen, oder das gesamte Feld von Berufsprüfungen und -zulassungen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass derjenige, der eine solche Gefahr herbeiführt, gerade bezogen auf die spezielle Funktion, die er ausübt, in Anspruch genommen wird.
160
Aus dem Bezugspunkt des Gefährdungsdelikts auf einen konkreten Erfahrungsraum folgt eine wesentliche Begrenzung des Verantwortungsbereichs der Normadressaten. Gerade weil die Normadressaten in ganz speziellen Situationen angesprochen werden, können sie nicht wegen der Schaffung von Gefahren haftbar gemacht werden, die zwar auch verboten sind, deren Vermeidung aber nicht in ihren speziellen Aufgabenbereich fällt.
Beispiel:
Wer etwa zur Verhinderung einer Überschwemmung gem. § 313 StGB dafür zu sorgen hat, dass ein Wasserrückhaltebecken nicht überläuft, haftet nicht für Umweltgefährdungen gem. §§ 324a, 326 StGB oder ähnlichen Delikten, wenn er fahrlässigerweise ein Ablaufventil öffnet, anstatt es zu verschließen, und das Wasser zuvor von Dritten illegal mit giftigen Chemikalien versetzt wurde[357].
Aus demselben Grund muss im Fall eines tatsächlich nicht gefährlichen Verhaltens der Einwand der Ungefährlichkeit für die durch den Tatbestand geschützten Güter zulässig sein[358].
cc) Verzichtbarkeit auf das Erfordernis eines besonderen Gefährdungserfolgs
Читать дальше