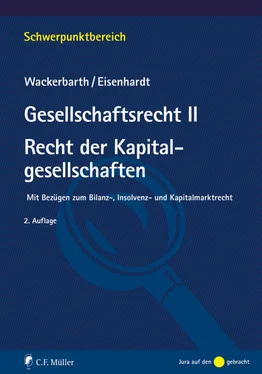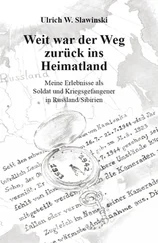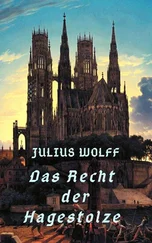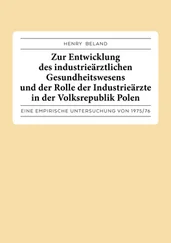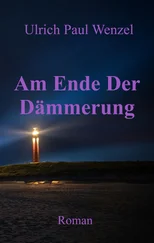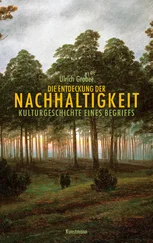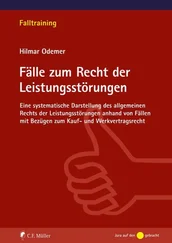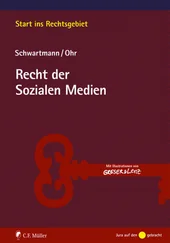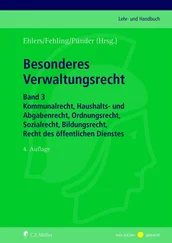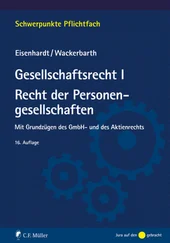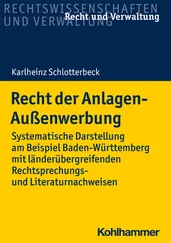1 ...6 7 8 10 11 12 ...43 Die Frage ist zu verneinen. Der erwirtschaftete Gewinn ist im Verhältnis 55:25:20 zu verteilen. Eine Änderung der Gewinnverteilungsregel kann A nicht durch einfachen Beschluss bewirken, sondern nur durch eine Satzungsänderung, der die übrigen Gesellschafter zustimmen müssen, weil die Änderung ja zu ihren Lasten ginge (§ 53 Abs. 3 GmbHG).
20
Abwandlung des Beispiels:
Da A nicht mit der Zustimmung seiner beiden Mitgesellschafter rechnet, greift er zu anderen Mitteln: Er nimmt sich zwar nicht einfach die ihm (wie er ja glaubt) zustehenden 20.000 € aus der Kasse der Gesellschaft, aber er schlägt dem Geschäftsführer X der GmbH ein Austauschgeschäft vor. Geplant ist, dass A der Gesellschaft eine Leistung erbringt, z. B. einen Pkw verkauft, und die GmbH ihrerseits die Leistung des A mit 20.000 € über dem Marktwert des Pkw vergütet.
A hat die Mehrheit der Stimmrechte und kann mit seiner den Geschäftsführer der GmbH abbestellen und entlassen. Diese Möglichkeit verleiht seinen Wünschen Nachdruck. X wird sich daher möglicherweise für die GmbH auf das Geschäft einlassen. B und C dagegen wird das Geschäft nicht gefallen: Das wirtschaftliche Ergebnis des Vorgangs ist das gleiche, wie wenn A das Geld einfach aus der Kasse der Gesellschaft genommen hätte oder aber die Gewinnverteilungsregel im Sinne des A abgeändert worden wäre. Das Austauschgeschäft verschleiert also nur die durchgeführte Vermögensverlagerung von der GmbH hin zu A (sog. verdeckte Vermögensverlagerung oder verdeckte Gewinnausschüttung).
2. Mögliche rechtliche Konsequenzen
a) Verbot von Austauschgeschäften?
21
Mit dem dargestellten Austauschgeschäft wird also die geltende Gewinnverteilungsregel umgangen. Wie aber soll das Recht nun darauf reagieren? Man könnte etwa auf den Gedanken kommen, Austauschgeschäfte zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern vollständig zu verbieten. Wären diese Geschäfte verboten, so könnte es zu der dargestellten Umgehung gar nicht erst kommen. Das würde allerdings zu weit gehen. Denn es ist durchaus auch denkbar, dass in einer konkreten Situation die (Gegen-)Leistung des Gesellschafters ihren Preis wert ist und für die Gesellschaft notwendig oder sogar vorteilhaft ist.
Abwandlung des Beispielsfalles:
A verfügt über ein Grundstück, auf das die Gesellschaft momentan angewiesen ist, da sie ihren Produktionsbetrieb erweitern will und das Grundstück günstig liegt.
In einem solchen Fall werden die anderen Gesellschafter gegen den Vertrag mit A nichts einzuwenden haben, soweit er zu einem vernünftigen Preis zustande kommt. Ein vollständiges Verbot von Austauschgeschäften ist deshalb abzulehnen.
b) Veto-Recht der anderen Gesellschafter
22
Erforderlich ist aber, dass, wegen der beschriebenen Gefahr einer Vermögensverlagerung, der A über den Kaufvertrag nicht nur mit dem von ihm abhängigen und daher erpressbaren Geschäftsführer „verhandelt“ (dieser wird sich gegen einen unfairen Preis kaum wehren, da er weiß, dass A ihn entlassen könnte). Vielmehr müssen die beiden anderen Gesellschafter ein Veto -Rechtgegen das Austauschgeschäft besitzen, so dass A nicht ohne ihre Zustimmung den Vertrag mit der GmbH abschließen kann. Folglich muss er mit ihnen verhandeln. B und C können also den problematischen Vertrag verhindern. Sie werden es freilich nicht tun, wenn er zu Bedingungen zustande kommt, die für beide Seiten (d. h. für A und die Gesellschaft) vorteilhaft sind. Auf diese Weise können sinnvolle Geschäfte dieses Kontrollverfahren passieren, während eine verdeckte Vermögensverlagerung praktisch ausgeschlossen ist.
23
Diese hier angebotene grundsätzliche Lösung des Problems besteht also darin, die Minderheitsgesellschafter als Kontrollinstanzfür die Frage heranzuziehen, ob sogenannte In-Sich-Geschäfte rechtlich akzeptiert werden oder nicht. Der Mehrheitsgesellschafter soll nicht auf beiden Seiten des Geschäfts stehen können und seine Mehrheitsmacht innerhalb der Gesellschaft ausspielen können. Vielmehr soll er – wie in einer Marktwirtschaft üblich – bei derartigen Austauschgeschäften[7] mit anderen, namentlich mit seinen Mitgesellschaftern, über den Preis verhandeln müssen. Im deutschen GmbH-Recht ist diese Notwendigkeit von Verhandlungen durch § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG auch gesetzlich anerkannt, während im Aktienrecht andere Lösungen diskutiert werden, siehe dazu das Folgende.
24
Insbesondere im Aktienrecht wird das beschriebene Kontrollverfahren für solche Austauschgeschäfte für zu umständlich gehalten und deshalb auf andere Lösungen ausgewichen. Zum einen wird bereits eine hypothetische Verhandlung über den Preis für eine Leistung des Gesellschafters für ausreichend gehalten. Dann wäre das Geschäft zwischen A und der Gesellschaft auch dann gültig, wenn B und C tatsächlich nicht zugestimmt haben, solange es nur „zu Marktpreisen“zustande gekommen ist. Oder aber man befragt nicht B und C, sondern einen unabhängigen Dritten,der das Geschäft zwischen A und der Gesellschaft genehmigt. Im praktischen Ergebnis würde A dann mit diesem unabhängigen Dritten verhandeln müssen.
25
Gegen beide Alternativen bestehen Einwände, die später ( Rn. 618 ff.und 971) noch etwas näher diskutiert werden. Hier nur so viel: Es besteht einerseits stets das Risiko, dass die Vorhersagedes Ausgangs einer solchen hypothetischen Verhandlung fehlerhaftist, so dass etwa im konkreten Fall der Marktpreis nicht das ist, worauf sich die Gesellschafter bei vollständiger Information tatsächlich geeinigt hätten. „Marktpreise“ liefern ohnehin nur ein ungenaues Ergebnis, da sie von einem Sachverständigen ermittelt werden müssen, der stets eine Bandbreitevon angemessenen Preisen angibt.
Und die zweite Alternative, eine Verhandlung mit einem unabhängigen Dritten, um Streit zwischen den Gesellschaftern zu verhindern, geht im Ergebnis zu Lasten von B und C. Der „Unabhängige“ (also eine neutrale Person, die weder zu A noch zu B oder C in einer familiären oder freundschaftlichen Beziehung steht) verhandelt dann mit A. Das praktische Ergebniseiner solchen Verhandlung wird (statistisch betrachtet) in der Mitte zwischen dem Neutralen und A liegen und das ist weniger als die Mitte zwischen A und den gegenläufig interessierten Gesellschaftern B und C. Ein Unabhängiger kann also nicht das leisten, was Verhandlungen zwischen den Gesellschaftern leisten können.
3. Verdeckte Vermögensverlagerungen und Gläubigerschutz
26
Durch die Haftungsbeschränkung im Kapitalgesellschaftsrecht bedingt ist noch ein weiteres Problem verdeckter Gewinnausschüttungen. Unterstellt wird, A, B und C seien sich einig und schließen sämtlich ähnliche Austauschverträge mit der GmbH, so dass im Ergebnis Vermögensverlagerungen hin zu allen drei Gesellschaftern entsprechend dem Verhältnis ihrer Anteile stattgefunden haben. Die gesellschaftsrechtlicheProblematik verschwindet in diesem Fall. Für die Gläubiger stellen diese (drei) Verlagerungen jedoch ein zentrales Problem dar. Denn sie vermindern das Vermögen der Kapitalgesellschaft, das allein den Gläubigern haftet (§ 1 AktG, § 13 Abs. 2 GmbHG). Austauschverträge zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern müssen daher auch aus Gründen des Gläubigerschutzes auf die Prüfbank, um einen Mittelabfluss zu verhindern, wenn und soweit er die Gläubiger gefährdet.
27
Lösung zu Fall 1:
B und C könnten einen Anspruch der X-GmbH gegen A auf Zahlung von 10.000 € geltend machen, wenn ein solcher Anspruch besteht und B und C ihn geltend machen können.
Читать дальше