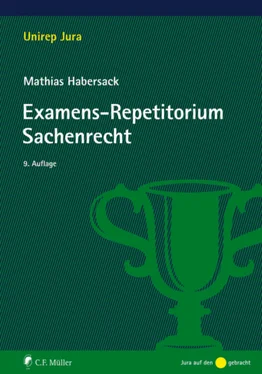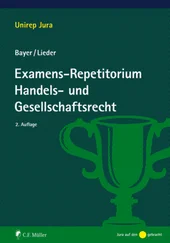Inhaltsverzeichnis
§ 1 Begriff und Gegenstand des Sachenrechts
§ 2 Die sogenannten Sachenrechtsgrundsätze
§ 3 Das dingliche Rechtsgeschäft
§ 4 Grundbegriffe
Erster Teil Grundlagen› § 1 Begriff und Gegenstand des Sachenrechts
§ 1 Begriff und Gegenstand des Sachenrechts
Inhaltsverzeichnis
I. Wesen der Sachenrechte
II. Rechtsobjekt und Verfügungsobjekt
I. Wesen der Sachenrechte
1. Sachenrechte als Herrschaftsrechte
1
Das Sachenrecht als Teil des Bürgerlichen Rechts verdankt seinen Namen dem Umstand, dass es vor allem ( Rn. 21 f.) die Rechtsverhältnisse an Sachenregelt. Der Gegenstand der sachenrechtlichen Vorschriften, die „Sache“ ( Rn. 5 ff.), ist es also, der die Eigenständigkeit des Sachenrechts begründet. Da die Sache ein real, also auch außerhalb des Rechts existierendes Gebilde ist und sich dadurch insbesondere von der Forderung unterscheidet, steht jede Rechtsordnung vor der grundsätzlichen Frage, ob sie subjektive Rechte einzelner Rechtssubjekte an diesen Gegenständen anerkennt. Wird dies bejaht, so ist des Weiteren zu regeln, unter welchen Voraussetzungen diese Rechte an Sachen entstehen, erlöschen und übertragen werden. Ferner muss geregelt werden, welchen Inhalt die einzelnen Rechte haben; insbesondere bedarf es der Abgrenzung zu konkurrierenden Rechten. Schließlich fragt sich, ob und, wenn ja, auf welche Weise die Rechte an Sachen geschützt sind.
2
Verschiedentlich wird gesagt, das Sachenrecht sei das Recht, das die Güter zuordne, sei also Zuordnungsrecht[1]. In der Tat kommt dem Sachenrecht diese Aufgabe zu. Indes begegnet die Zuordnung von Rechtsobjekten auch außerhalb des Sachenrechts. So regelt das Schuldrecht, welcher Person die Forderung „zusteht“; es weist also dem Gläubiger die Forderung zu. Das Erbrecht beantwortet unter anderem die Frage nach dem Schicksal des Nachlasses; es ordnet denselben dem oder den Erben zu. Das Immaterialgüterrecht schließlich handelt von der Zuordnung geistiger Werke. Die Zuordnung von Gegenständen ist demnach mitnichten ein Charakteristikum gerade des Sachenrechts[2]. Kennzeichnend für das Sachenrecht ist vielmehr die – durch den zugeordneten Gegenstand bedingte – Art der Zuordnung und damit der Inhalt des subjektiven Rechts: Die Zuordnung bezieht sich auf Sachen und erfolgt mit Wirkung gegenüber jedermann, also „absolut“.
→ Definition:
Das Sachenrecht regelt mit anderen Worten „Herrschaftsrechte“ an Sachen, Rechte also, die den Inhaber berechtigen, auf eine Sache einzuwirken und Dritte von der Einwirkung auf diese Sache auszuschließen. Nicht die Zuordnung als solche, sondern die Zuordnung von Sachen ist Aufgabe des Sachenrechts.
2. Sachenrechte im System der subjektiven Rechte
3
Die deutsche Rechtsordnung kennt neben den Sachenrechten noch andere Herrschaftsrechte. Von besonderer Bedeutung sind die Immaterialgüterrechte, also das Patentrecht, das Urheberrecht, Marken und geschäftliche Bezeichnungen. Von den Sachenrechten unterscheiden sie sich allein dadurch, dass sie sich auf einen unkörperlichen Gegenstand, etwa das Geisteswerk oder die Erfindung, beziehen und diesen mit Wirkung gegenüber jedermann dem Berechtigten zuweisen. Sie sind somit zwar absolute Rechte, aber keine „dinglichen“ Rechte. Entsprechendes gilt für die Mitgliedschaft[3]. Was dagegen das Leben, die Gesundheit, die Freiheit und das Persönlichkeitsrecht betrifft, so handelt es sich um Ausprägungen der Persönlichkeit selbst; da diese nicht Gegenstand eines subjektiven Rechts sein kann, handelt es sich bei den genannten Positionen nicht um Herrschaftsrechte, sondern um Rechtsgüter[4]. Den Rechtsgütern nahe stehend sind schließlich die Familienrechte[5].
4
Sämtliche Herrschaftsrechte sind also dadurch gekennzeichnet, dass sie ihrem Inhaber einen außerhalb des subjektiven Rechts bestehenden Gegenstand, ein Rechtsobjekt[6] – sei es eine Sache oder einen anderen Gegenstand ( Rn. 5 ff.) – zuordnen und ihn berechtigen, auf diesen Gegenstand einzuwirken und Dritte von der Einwirkung auszuschließen. Die Forderungerschöpft sich dagegen in sich selbst[7]; eine unmittelbare Subjekt-Objekt-Beziehung fehlt ihr selbst dann, wenn man zwischen Forderung und Anspruch unterscheiden und als Gegenstand der Forderung den Anspruch ansehen wollte[8]. Gestaltungsrechteschließlich verleihen dem Inhaber die Befugnis, ein Rechtsverhältnis zustandezubringen oder auf ein bestehendes Rechtsverhältnis einzuwirken. Sie begegnen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sachenrechts. Auch soweit sie, wie die dinglichen Aneignungsrechte[9], darauf gerichtet sind, ein Herrschaftsrecht an einer Sache zu begründen, erfolgt doch die Zuordnung des Gegenstands erst aufgrund der Ausübung des Gestaltungsrechts.
II. Rechtsobjekt und Verfügungsobjekt
1. Sachen und andere Rechtsobjekte
5
Die Vorschriften der §§ 854 ff. regeln die Rechtsverhältnisse an Sachen und knüpfen damit an die Definitionsnorm des § 90 an.
→ Definition:
Sachen im Rechtssinne sind danach nur körperliche Gegenstände; grundsätzlich kann deshalb nur an ihnen Eigentum, ein beschränktes dingliches Recht oder Besitz bestehen.
Der Begriff der Sache wirft freilich eine Vielzahl von Fragen auf[10]. Dies gilt weniger für die – Symbolcharakter aufweisende – Sondervorschrift des § 90a, wonach Tierezwar keine Sachen sind, indes den für Sachen geltenden Vorschriften unterliegen und somit ebenfalls einen Gegenstand dinglicher Rechte bilden. Schon die Frage, ob Dateneigentumsfähig sind, ist freilich nicht leicht zu beantworten. Klar ist zunächst, dass der Datenträger (etwa ein USB-Stick) Sacheigenschaft hat; auch können Daten, soweit sie, wie namentlich „Software“, das Resultat geistiger Leistung sind, immaterialgüterrechtlichen Schutz genießen[11]. Hingegen fehlt es Daten als solchen (mögen sie auf einem körperlichen Datenträger oder in der Cloud gespeichert sein) – ebenso wie beispielsweise elektrischer Energie[12] – de lege lata[13] an der im Rahmen des § 90 unerlässlichen Körperlichkeit[14]. Einen Schutz des Rechts an Daten nach § 823 Abs. 1 muss dies zwar nicht ausschließen[15]; für die Anerkennung von Dateneigentum im sachenrechtlichen, auf die Möglichkeit der Zuordnung eines körperlichen und damit beherrschbaren Gegenstands abstellenden Sinne ist hingegen kein Raum. Davon betroffen sind auch „digitale Wertpapiere“, darunter auch auf Blockchain-Transaktionen zurückgehende Kryptokoken(insbesondere BitCoins)[16]. Sie lassen sich de lege lata schon deshalb nicht als Wertpapiere qualifizieren, weil es ihnen an der Verkörperung eines Rechts in einer Urkunde (die nach §§ 929 ff. übertragen und nach Maßgabe der §§ 932 ff. auch vom Nichtberechtigten erworben werden kann, s. Rn. 353a) fehlt[17]. Doch plant der Gesetzgeber, digitale Wertpapiere durch Fiktion zu Sachen zu erklären und in einem elektronischen Wertpapierregister zu erfassen[18].
6
Von den körperlichen sind die unkörperlichen Gegenständezu unterscheiden. Bei ihnen handelt es sich vor allem[19] um die bereits erwähnten geistigen Werke und Daten. Wie die Sachen existieren auch diese Gegenstände außerhalb der Rechtsordnung; auch insoweit steht die Rechtsordnung vor der Frage, ob und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen sie Rechte (nämlich die Immaterialgüterrechte) anerkennt, die sich auf diese unkörperlichen Gegenstände beziehen[20]. Man kann die körperlichen und unkörperlichen Gegenstände auch als Rechtsobjekte bezeichnen und dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie Gegenstand eines Rechts sind[21]. Davon zu unterscheiden sind die Verfügungsobjekte, also die Gegenstände, über die verfügt wird ( Rn. 13).
Читать дальше