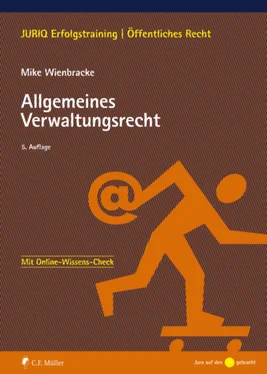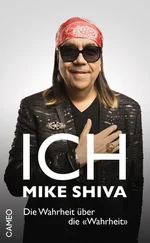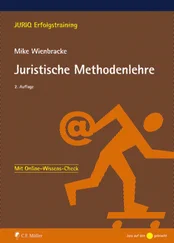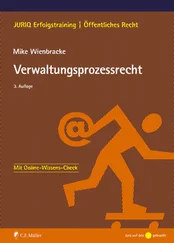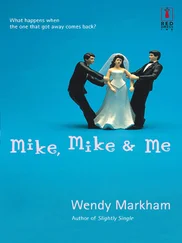Hinweis
Klassisch insoweit der von Carl Friedrich von Savigny [177] formulierte Merksatz: „Die Bedingung […] suspendi[e]rt, zwingt aber nicht; der Modus [ scil. die Auflage] zwingt, suspendi[e]rt aber nicht.“
90
Ob überhaupt[178] eine und gegebenenfalls welche Art von Nebenbestimmung im konkreten Fall vorliegt, ist im Wege der Auslegungder betreffenden behördlichen Regelung nach ihrem objektiven Erklärungswert zu ermitteln (vgl. Rn. 42und Rn. 55). Maßgeblich ist deren materieller Gehalt, nicht die formelle Bezeichnung (z.B. als „Auflage“, „Bedingung“) – sofern Letztere überhaupt unter Rückgriff auf die in § 36 Abs. 2 VwVfG verwendeten Termini erfolgt (Negativbeispiele: „Maßgabe“, „Zusatz“ etc.). Die Wortwahl ist vielmehr lediglich ein erstes Indiz dafür, was die Behörde tatsächlich gewollt hat. Selbst hinter einer scheinbar unzweideutig als „Auflage“ bezeichneten Regelung kann sich daher eine Bedingung – oder gar eine Inhaltsbestimmung ( Rn. 91) – verbergen bzw. sich eine „auflösende Bedingung“ aus Sicht eines objektiven Empfängers als vorläufiger Zuwendungsbescheid darstellen ( Rn. 65).
Eine Bedingung liegt i.d.R. nur dann vor, wenn die Beachtung der jeweiligen behördlichen Verhaltensvorgabe derart bedeutsam ist, dass die Wirksamkeit des Verwaltungsakts mit ihr „steht oder fällt“[179]. Im Zweifelist daher grundsätzlich von einer Auflageauszugehen, da diese sich aufgrund ihrer selbstständigen Durchsetzbarkeit sowohl für die Behörde als auch angesichts der von ihr unberührt bleibenden Wirksamkeit des Verwaltungsakts für den Betroffenen als die günstigere Maßnahme darstellt. Abweichendes gilt freilich dann, wenn eine dieser beiden Arten von Nebenbestimmungen im Einzelfall unzulässig sein sollte. In einem solchen Fall ist im Zweifel nämlich davon auszugehen, dass die Behörde sich rechtmäßig verhalten, d.h. die allein zulässige Nebenbestimmung gewählt hat.
Beispiel[180]
G beabsichtigt, in der Bonner Südstadt eine Gaststätte zu betreiben und beantragt daher bei der zuständigen Behörde eine entsprechende Erlaubnis. Diese wird ihm auch erteilt, allerdings mit der „Maßgabe“
| a) |
die bisher allein bestehende Unisex-Toilette durch zehn getrennte Toilettenanlagen für Frauen und Männer zu ersetzen; |
| b) |
über die neun bereits vorhandenen Toiletten hinaus noch eine weitere zu errichten. |
In Fall a) ist bislang keine (angemessene) Toilettenanlage vorhanden. Bis diese eingebaut wird, soll die Gaststätte nach dem Willen der Behörde nicht in Betrieb gehen. Bei der „Maßgabe“ handelt es sich daher um eine aufschiebende Bedingung i.S.v. § 36 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG NRW. Anders dagegen in Konstellation b). In Anbetracht der neun bereits existierenden Toilettenanlagen besitzt die „Maßgabe“ der Errichtung einer weiteren Toilette hier für die Behörde nicht dieselbe Bedeutung wie in Fall a). Insoweit handelt es sich nur um eine Auflage i.S.v. § 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG NRW.
91
Von den Nebenbestimmungen i.S.v. § 36 VwVfG zu unterscheiden sind die Inhaltsbestimmungen, vgl. auch § 10 Abs. 5 S. 2 BImSchG. Während namentlich die Auflage zu der im Verwaltungsakt ausgesprochenen Hauptregelung hinzutritt (z.B. Baugenehmigung mit dem Zusatz, an der Außentreppe ein Geländer anzubringen; Rn. 77und Rn. 80), legen Inhaltsbestimmungen erst den Gegenstand und die Grenzen eines Verwaltungsakts, d.h. den Inhalt seiner „Regelung“ i.S.v. § 35 S. 1 VwVfG, fest ( Rn. 54 ff.; z.B. Ausnahmeerlaubnis gem. § 46 StVO zum Parken auf gekennzeichneten Bewohnerparkplätzen im Bereich Altschwabing). Zu Letzteren zählt richtigerweise auch die erstmalig von Weyreuther [181] sog. modifizierende Auflage, die entgegen ihrer (Falsch-)Bezeichnung als „Auflage“ keine Nebenbestimmung i.S.v. § 36 VwVfG ist. Bei dieser erhält der Bürger nicht das, was er beantragt hat – und das, was er erhält, hat er nicht beantragt ( aliud ; z.B. Genehmigung eines Wohnhauses mit Flach- anstatt des beantragten Satteldachs). Macht der Bürger von der eingeschränkten bzw. veränderten Genehmigung gleichwohl Gebrauch, so liegt hierin die konkludente nachträgliche Stellung des etwaig erforderlichen Antrags, vgl. § 45 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG (Rn. 197). Andernfalls muss er eine Verpflichtungsklage auf Erteilung einer uneingeschränkten Genehmigung erheben.[182]
Hinweis
„Begrifflich setzt eine Nebenbestimmung eine Haupt-[/Inhalts]Bestimmung voraus.“[183] „Während die Nebenbestimmungeine zusätzliche Regelung zu einem inhaltlich bestimmten Verwaltungsakt trifft, legt die [Haupt-/] Inhaltsbestimmungerst den Gegenstand und die Grenzen des Verwaltungsakts fest.“[184]
92
Die Differenzierung zwischen einer Inhaltsbestimmung(inkl. der modifizierenden Auflage) einerseits und der Auflageandererseits hat auch praktisch erhebliche Bedeutung: Hält sich der Adressat eines Verwaltungsakts, dessen Inhalt im Vergleich zum gestellten Antrag eingeschränkt oder verändert ist, nicht an diese Inhaltsbestimmung, so handelt er ohne Erlaubnis und damit rechtswidrig. Verstößt er dagegen „nur“ gegen eine Auflage zum antragsgemäß erteilten Verwaltungsakt, so handelt der Betroffene aufgrund der im Verwaltungsakt enthaltenen Sachregelung nicht ohne Erlaubnis. Vielmehr kann die in der Auflage enthaltene weitere Sachregelung von der Behörde nur im Wege der Verwaltungsvollstreckung durchgesetzt werden (Auflage als Grundverwaltungsakt) bzw. kann die Behörde den Hauptverwaltungsakt (die Genehmigung) unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 VwVfG widerrufen ( Rn. 89).
Beispiel[185]
Das Gewerbeaufsichtsamt hat Fabrikant F eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Ölfeuerungsanlage erteilt „mit der Maßgabe, dass bei Ölfeuerungsbetrieb mit schwerem Heizöl nur Heizöl S mit einem Schwefelgehalt von höchstens 1 % verfeuert werden darf“. F möchte wissen, wie es rechtlich zu bewerten ist, wenn er die Anlage entgegen dieser Maßgabe nicht mit schwefelarmem Heizöl betreiben würde.
Die behördliche Maßgabe, welche bei Ölfeuerungsbetrieb mit schwerem Heizöl nur die Verwendung von Heizöl S mit einem Schwefelgehalt von höchstens 1 % gestattet, ist keine Auflage. Sie kennzeichnet vielmehr den Umfang der dem F erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. F ist nicht schlechthin, sondern nur für den Fall der Verwendung von schwefelarmem Heizöl gestattet worden, eine Ölfeuerungsanlage zu betreiben. Verwendet er anderes Öl, so verstößt er nicht gegen eine Auflage, sondern betreibt die Anlage ungenehmigt.
93
Die Abgrenzungder Inhaltsbestimmungvon der Nebenbestimmungerfolgt – ebenso wie die Abgrenzung der verschiedenen Arten von Nebenbestimmungen untereinander – im Wege der Auslegung(vgl. Rn. 90). Eine Inhaltsbestimmung liegt regelmäßig dann vor, wenn bestimmte typische Rechtsfolgen, die mit dem Verwaltungsakt normalerweise (nach dem Gesetz) verbunden sind, entweder vollständig ausgeschlossen oder aber inhaltlich modifiziert werden.
Beispiel[186]
Autofahrer A besitzt noch einen Führerschein der Klasse 4 mit folgendem Eintrag: „Wegen Erblindung des linken Auges ist beim Führen von Fahrzeugen mit offenem Führersitz eine Schutzbrille zu tragen.“ Als Halter eines Leichtkraftrads war A bei der V-Versicherungs AG gegen Haftpflicht versichert. Nachdem A, der ohne Schutzbrille fuhr, mit einem von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Mopedfahrer zusammengestoßen war, verstarb Letzterer noch an der Unfallstelle. V lehnte es daraufhin ab, dem A Versicherungsschutz zu gewähren, weil er bei der Unfallfahrt keine Schutzbrille getragen und damit bei Eintritt des Versicherungsfalls nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis gehabt habe. Vor dem zuständigen Landgericht begehrt A nunmehr, die Deckungspflicht von V festzustellen. Hat A in der Sache Recht?
Читать дальше