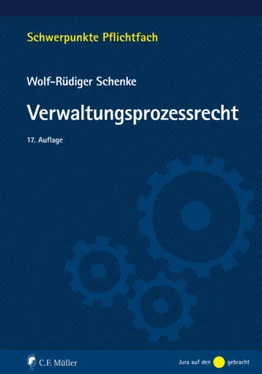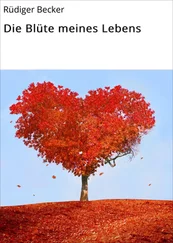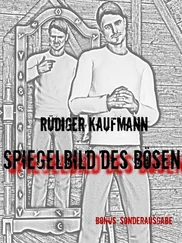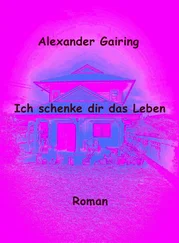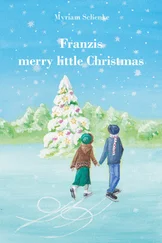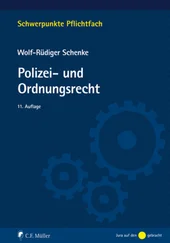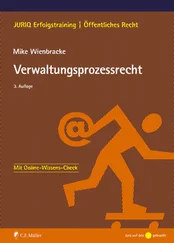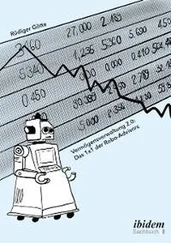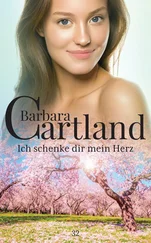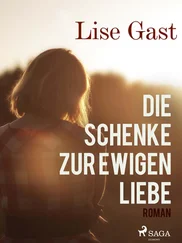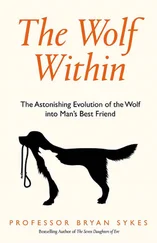242
An einer Regelung mit Außenwirkung fehlt es grundsätzlich auch dann, wenn eine staatliche Aufsichtsbehörde einer Gemeinde bzw einem Landkreis[45] im übertragenen Wirkungsbereich (der strikt vom Selbstverwaltungsbereich zu trennen ist) Weisungen erteilt. Die insoweit der Fachaufsicht unterliegenden Gemeinden bzw Landkreise handeln nämlich insoweit nur als verlängerter Arm des Staatesund werden damit nicht in ihrer eigenen subjektiven Rechtsstellung betroffen. Widersprüchlich ist es insbesondere[46], die Außenwirkung zwar unter Hinweis darauf zu bejahen, dass die Selbstverwaltungskörperschaften niemals integraler Bestandteil staatlicher Verwaltung seien, die gegen solche staatlichen Aufsichtsmaßnahmen gerichteten gemeindlichen Klagen jedoch teilweise mangels Klagebefugnis (vgl Rn 517 ff) für unzulässig zu halten. Nur wenn das Landesrecht den Körperschaften auch bezüglich der Angelegenheiten, die ihnen staatlicherseits übertragen wurden, subjektive Rechte einräumt, stellt sich eine entsprechende Weisung als von der staatlichen Behörde intendierte Regelung mit Außenwirkung dar[47]. Zu beachten ist allerdings, dass Widerspruchsbescheide, die von der staatlichen Widerspruchsbehörde (idR also der Aufsichtsbehörde) auf Grund eines gegen einen gemeindlichen Verwaltungsakt gerichteten Widerspruchs (dazu Rn 694 ff) erlassen werden (und diesen möglicherweise aufheben oder ändern), stets Verwaltungsakte sind ( Rn 200und Koehl , BayVBl. 2003, 331 ff). Jedoch wird eine von der Gemeinde gegen den Widerspruchsbescheid erhobene Anfechtungsklage, soweit der Verwaltungsakt staatlicherseits übertragene Angelegenheiten betrifft, idR wegen mangelnder Klagebefugnis unzulässig sein (s. ein Beispiel unten Rn 260). Aufsichtsbehördliche Regelungen, welche die Gemeinden (oder sonstige mit einem Selbstverwaltungsrecht ausgestattete juristische Personen des öffentlichen Rechts) im Selbstverwaltungsbereichbetreffen, sind dagegen meist als Verwaltungsakte zu qualifizieren, die die betroffene Gemeinde anfechten kann. Eine Anfechtung durch Dritte scheidet dagegen meist aufgrund fehlender Klagebefugnis aus ( Schoch , Jura 2006, 188, 196). Die Rechtsnatur einer kommunalaufsichtlichen Ersatzvornahmehängt davon ab, welche Rechtsnatur die ersetzte Handlung hat. Bezieht sich die Ersatzvornahme auf einen Verwaltungsakt, ist sie selbst ein Verwaltungsakt, betrifft sie hingegen eine Rechtsnorm, so ist sie eine Rechtnorm. Aus rechtslogischen Gründen nicht haltbar (s. Rn 228) ist auch hier die Bejahung einer Doppelnatur in dem Sinne, dass die im Wege der kommunalaufsichtlichen Ersatzvornahme erlassene Norm dem Bürger gegenüber als Rechtsnorm, der Gemeinde gegenüber hingegen als Verwaltungsakt zu qualifizieren sein soll[48].
243
Sehr umstritten ist die Frage der Rechtsnatur einer Einvernehmens- oder Zustimmungserklärung einer anderen Behörde, die zum Erlass eines mehrstufigen Verwaltungsaktserforderlich ist (vgl Budroweit , S. 122 ff).
244
Beispiel:
Eine Gemeinde verweigert das nach § 36 BauGB für die Erteilung einer Baugenehmigung erforderliche Einvernehmen[49].
245
Wäre in dem Einvernehmen ein Verwaltungsakt zu sehen, so könnte der Bauantragsteller bei dessen Ablehnung mittels einer Verpflichtungsklage auf dessen Erteilung klagen. Das BVerwG lehnt dies unter Hinweis darauf ab, dass Einvernehmen bzw Zustimmung dem Bauantragsteller nicht mitgeteilt werden und die eigentliche Entscheidung mit Außenwirkung erst in der Baugenehmigung bzw deren Ablehnungliege. Als Rechtfertigung für diese – in ihrer dogmatischen Begründung durchaus anfechtbare (s. unten) – These führt das BVerwG ferner an, dass sich der Betroffene andernfalls zu einem doppelten gerichtlichen Vorgehengezwungen sähe und im Falle der Verweigerung des Einvernehmens und einer sich daran anschließenden Ablehnung der Baugenehmigung gegen beide Maßnahmen klageweise vorgehen müsste. Das widersprächenicht nur dem Grundsatz der Prozessökonomie, sondern auch jenem der Effektivität des Rechtsschutzes. Diese Argumentation überzeugt nicht. Für die – im Ergebnis zutreffende – Verneinung eines isolierten Rechtsschutzes gegen die Verweigerung der Mitwirkungshandlung dürfte vielmehr mE vor allem § 44asprechen (vgl Schenke , JZ 1996, 1008 und Rn 613 f sowie ausführlich Budroweit , S. 323 ff). Aus ihm lässt sich nämlich mühelos ableiten, dass nur auf die Erteilung der Baugenehmigung zu klagen ist, obwohl die Erteilung des Einvernehmens unbestrittenermaßen Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für die Baugenehmigung ist (und insofern entgegen dem BVerwG eben doch eine Außenwirkung aufweist). Das Verwaltungsgericht ersetzt (anders als die Widerspruchsbehörde, s. Rn 743) bei einer Verurteilung des Staates zum Erlass des begehrten Verwaltungsakts zugleich auch konkludent das fehlende Einvernehmen der bei dem Prozess beizuladenden (s. Rn 493) Gemeinde und/oder höheren Verwaltungsbehörde (vgl hierzu auch Budroweit , S. 351 ff). Entsprechendes gilt für die Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde nach § 9 Abs. 2 FStrG[50] oder eine nach § 12 Abs. 2 LuftVG erforderliche Zustimmung der Luftfahrtbehörde zur Errichtung von Bauwerken. Zu beachten ist, dass die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 Abs. 2 S. 3 BauGB oder im Wege der Rechtsaufsicht auf jeden Fall einen Verwaltungsakt darstellt, da sie gegenüber der in ihrer Planungshoheit betroffenen Gemeinde eine Regelung trifft ( Ehlers , JK 01, BauGB § 36/4; aA Klinger , BayVBl. 2002, 481 ff). Allerdings scheitert auch hier eine Anfechtungsklage der Gemeinde an § 44a (s. Rn 614).
Nicht nur eine interne Mitwirkung einer Behörde beim Erlass eines Verwaltungsakts liegt dann vor, wenn diese über Aspekte zu befinden hat, die außerhalb der Regelungsbefugnis der den mehrstufigen Verwaltungsakt erlassenden Behörde liegt. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Entscheidung der mitwirkenden Behörde dem Betroffenen durch diese unmittelbar eröffnet wird, wie dies für den iVm der Erteilung einer Baugenehmigung erfolgenden Dispens nach § 9 Abs. 8 FStrG zutrifft[51].
246
Unterschiedlich beantwortet wird auch die Frage, ob sog. innerorganisatorische Aktezwischen kommunalen Verfassungsorganen oder deren Teilen, die Regelungen in Bezug auf Organrechte oder Organwalterrechte treffen, als Verwaltungsakte anzusehen sind (Problemkreis des sog. kommunalen Verfassungsorganstreits, s. hierzu auch Rn 139, 362, 370, 455, 478).
247
Beispiel:
Der Bürgermeister verweist ein störendes Gemeinderatsmitglied gem. § 36 Abs. 3 S. 1 BWGemO aus dem Beratungsraum.
248
Angesichts des weiten Behördenbegriffs, von dem § 1 Abs. 4 VwVfG ausgeht, bestehen hinsichtlich der Behördeneigenschaft keine Bedenken (str.)[52]. Ebenso erledigen sich auf das Fehlen eines Über- und Unterordnungsverhältnisses gestützte Einwände dann, wenn ein Organ bzw Organteil gegenüber anderen Organen bzw Organteilen zu einseitigen hoheitlichen Regelungen befugt ist. Scheitern kann die Qualifikation als Verwaltungsakt damit nur noch am Fehlen einer auf Außenwirkung gerichteten Regelung. Bei einer Stellungnahme hierzu ist zu beachten, dass bei Kommunalverfassungsorganstreitigkeitenheute allgemein anerkannt wird, dass auch intrapersonale Rechtsbeziehungen einer Subjektivierung zugänglich und damit klagefähig[53] sind. Verneint man mit der hM trotzdem die Außenwirkung, erhält dieses Tatbestandsmerkmal hier eine andere Funktion als beispielsweise bei Maßnahmen im besonderen Gewaltverhältnis (vgl Rn 233), denn dann dient es hier nicht dazu, die mangelnde Betroffenheit in eigenen Rechten zum Ausdruck zu bringen. Es erscheint daher nur konsequent, ähnlich wie bei interpersonalen Rechtsbeziehungen diese subjektivrechtliche Relevanz – entgegen der hM– mit Außenwirkung gleichzusetzen und das Vorliegen eines Verwaltungsakts zu bejahen[54]. Für diese hier vertretene Auffassung spricht zusätzlich, dass auch die hM bei der fortdauernden Verletzung von Organrechten von (ihrer Ansicht nach allerdings mittels einer Leistungsklage durchsetzbaren) Beseitigungsansprüchen ausgeht ( Rn 939) und hiermit der Sache nach ebenso wie auch sonst bei der Verletzung von Außenrechten (sekundäre) Reaktionsansprüche anerkennt (s. Rn 196, 545 ff). Diese sind aber bei rechtsverbindlichen Regelungen grundsätzlich mittels einer Anfechtungsklage durchsetzbar. Die sich von daher aufdrängende Qualifikation als Verwaltungsakt liegt auch deswegen sehr nahe, weil die sich auf Organrechte beziehenden Regelungen aus Gründen der Rechtssicherheit auch im Fall ihrer Fehlerhaftigkeit materiellrechtlich wie Verwaltungsakte zu behandeln und damit grundsätzlich rechtswirksam sind[55]. Für eine Gestaltungsklage in Anlehnung an die Anfechtungsklage Lange , in: Festschrift für Schenke, S. 959, 967.
Читать дальше