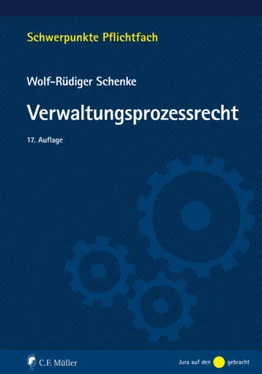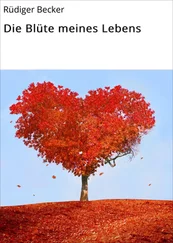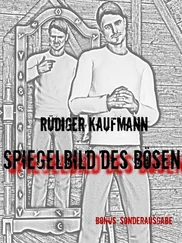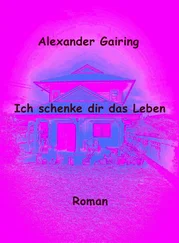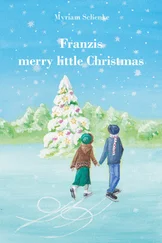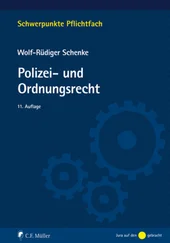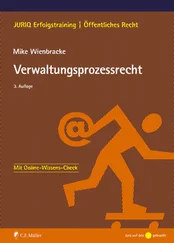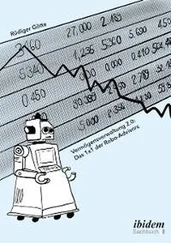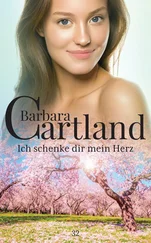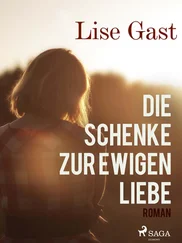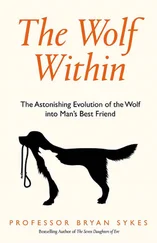1 ...7 8 9 11 12 13 ...45
b) Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung
28
Die wichtigsten Beweismittel sind gem. § 96 Abs. 1 der Augenschein, die Vernehmung von Zeugen, Sachverständigen und Beteiligten sowie die Heranziehung von Urkunden. Daneben können aber auch andere Erkenntnismittel herangezogen werden, zB amtliche Auskünfte[17]. Nach § 108 Abs. 1 S. 1 gilt auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Er besagt, dass eine Tatsache dann bewiesen ist, wenn das Gericht nach seiner freien, auf Grund des Gesamtergebnisses des Verfahrens gewonnenen Überzeugung – ohne Bindung an starre Beweisregeln (Ausnahmen zB § 173 iVm §§ 314, 415 ZPO) – die zu beweisende Tatsache für wahr, nicht lediglich für wahrscheinlich, hält. Dabei kann aber naturwissenschaftliche Gewissheit nicht verlangt werden; ausreichend ist vielmehr ein so hoher Grad an Wahrscheinlichkeit, dass dem Gericht keine vernünftigen Zweifel mehr möglich erscheinen.
§ 1 Einführung› III. Grundsätze des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens › 3. Amtsbetrieb und Konzentrationsgrundsatz
3. Amtsbetrieb und Konzentrationsgrundsatz
29
Das Betreiben des Prozesses, insbesondere die Zustellung von Entscheidungen und Ladungen, kann in die Hand des Gerichts (Amtsbetrieb)oder der Beteiligten (Parteibetrieb)gelegt sein. Die VwGO geht vom Amtsbetrieb aus. Danach erfolgt die Zustellung von Anordnungen und Entscheidungen, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird, sowie von Terminbestimmungen und Ladungen grundsätzlich von Amts wegen (s. näher §§ 56 Abs. 1, 102, 116 Abs. 1 S. 2). Der Amtsbetrieb ist eine wichtige Ergänzung des für das verwaltungsgerichtliche Verfahren geltenden Untersuchungsgrundsatzes.
30
Der Konzentrationsgrundsatzhat zum Ziel, einen Rechtsstreit möglichstin einer mündlichen Verhandlungzu erledigen. Dem dienen die von § 87 vorgesehenen Vorbereitungsmöglichkeiten und die in § 86 Abs. 3 u. 4 normierten verfahrensleitenden Befugnisse des Vorsitzenden oder Berichterstatters. Der Konzentrationsgrundsatz bildet ein bedeutsames Mittel zur Effektivierung des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes, für den das Zeitmoment von wesentlicher Bedeutung ist. Der Beschleunigung gerichtlicher Verfahren dienen auch eine Reihe von Sondervorschriften, die für Massenverfahren vorgesehen sind (zB §§ 56a, 67a), sowie das Musterverfahren nach § 93a, wenn die Rechtmäßigkeit einer behördlichen Maßnahme Gegenstand von mehr als zwanzig Verfahren ist.
§ 1 Einführung› III. Grundsätze des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens › 4. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs
4. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs
31
Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs stellt einen zentralen rechtsstaatlichen Bestandteil jedes gerichtlichen und damit auch des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens dar. Er ist als grundrechtsähnliches Verfahrensrecht(auf das sich nach hM selbst juristische Personen des öffentlichen Rechts berufen können) bereits auf der Verfassungsebene in Art. 103 Abs. 1 GG verankert und wird für den Verwaltungsprozess durch § 108 Abs. 2 dahingehend konkretisiert, dass ein Urteil nur auf solche Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden darf, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs ergibt sich auch die Verpflichtung des Gerichts, die Beteiligten auf solche Gesichtspunkte hinzuweisen, die bisher nicht Gegenstand der Verhandlung waren, nach Auffassung des Gerichts aber entscheidungserheblich sind.
32
Eine Verletzung des durch Art. 103 Abs. 1 GG geschützten Grundrechts auf rechtliches Gehör kann (grundsätzlich aber erst nach Erschöpfung des Rechtswegs) im Wege einer Verfassungsbeschwerde nach Maßgabe der §§ 90 ff BVerfGG geltend gemacht werden. Ist gegen eine gerichtliche Entscheidung kein Rechtsmittel oder ein anderer Rechtsbehelf gegeben, so kann der durch die Entscheidung Beschwerte nach näherer Maßgabe des 2004 neu erlassenen § 152aeine fristgebundene Anhörungsrügeerheben, mit der er die Verletzung des rechtlichen Gehörsgeltend macht (dazu eingehend Guckelberger , NVwZ 2005, 11 ff und Kopp/Schenke-W. Schenke , § 152a, Rn 1 ff). § 152a erging in Erfüllung eines Gesetzgebungsauftrags des BVerfG ( BVerfGE 107, 395 ff). Die Anhörungsrüge dient der Sicherung des durch die Verfahrensgrundrechte (insbesondere durch Art. 103 Abs. 1 GG) gebotenen Rechtsschutzes gegen richterlicher Akte (s. dazu näher auch Schenke , JZ 2005, 116 ff) wie auch der Entlastung des BVerfG. Ihre erfolglose Erhebung ist Voraussetzung für die Zulässigkeit einer auf die Verletzung rechtlichen Gehörs gestützten Verfassungsbeschwerde. Diese Rüge schließt nunmehr andere, früher als Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde zu absolvierende außerordentliche Rechtsbehelfe wie eine richterrechtlich entwickelte besondere Form der Gegenvorstellung[18] aber auch eine außerordentliche Beschwerde aus und ist entsprechend auf die Verletzung anderer Verfahrensgrundrechte (so auf Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG) anwendbar (sehr str., s. näher Schenke , NVwZ 2005, 729 ff).
§ 1 Einführung› III. Grundsätze des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens › 5. Die Grundsätze der Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und Öffentlichkeit des Verfahrens
5. Die Grundsätze der Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und Öffentlichkeit des Verfahrens
33
Für das verwaltungsgerichtliche Verfahren gilt grundsätzlich der Mündlichkeitsgrundsatz, demzufolge das Gericht auf Grund mündlicher Verhandlung entscheidet (§ 101 Abs. 1). Mit Einverständnis der Beteiligten kann die Entscheidung allerdings auch ohne mündliche Verhandlung ergehen (§ 101 Abs. 2)[19]. Entscheidungen des Gerichts, die nicht Urteile sind, können ohne mündliche Verhandlung ergehen, soweit nichts Anderes bestimmt ist (§ 101 Abs. 3). Gem. § 84 Abs. 1 darf auch ohne mündliche Verhandlung mittels Gerichtsbescheid entschieden werden, wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und der Sachverhalt geklärt ist. Zur nunmehr bestehenden Möglichkeit einer Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung s. § 102a (dazu Rn 70).
34
Eng verwandt mit dem Mündlichkeitsgrundsatz ist der Grundsatz der Unmittelbarkeit des Verfahrens. Gem. § 96 Abs. 1 hat die Beweisaufnahme in der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Gericht zu erfolgen (zu Einschränkungen vgl § 96 Abs. 2).
35
Flankierend tritt zu diesen Grundsätzen der Öffentlichkeitsgrundsatz(s. § 55 iVm § 169 GVG). Er erfordert, dass auch am Verfahren unbeteiligte Personen freien Zutritt zum Verhandlungsraum haben, soweit es die örtlichen und räumlichen Verhältnisse gestatten. Der Ausschluss der Öffentlichkeit für bestimmte Verfahren oder aus Gründen der Sitzungspolizei richtet sich nach den §§ 171a ff GVG. Nichtöffentlich ist die Verhandlung vor einem beauftragten oder ersuchten Richter (§ 96 Abs. 2). Hier gilt aber der sog. Grundsatz der Parteiöffentlichkeit, dh die Parteien werden von den Beweisterminen benachrichtigt und können der Beweisaufnahme beiwohnen (§ 97).
§ 1 Einführung› III. Grundsätze des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens › 6. Zeitgerechter Rechtsschutz
6. Zeitgerechter Rechtsschutz
36
In Konsequenz der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG[20] sowie der Art. 6 Abs. 1, 13 EMRK hat der gerichtliche Rechtsschutz innerhalb angemessener Zeit zu erfolgen und muss gegen dessen unangemessene Verzögerung die Möglichkeit eines Rechtsschutzes bestehen. In dem am 3.12.2011 in Kraft getretenen Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren (ÜVerfBesG) vom 24.11.2011 (BGBl. I S. 2302) wurde deshalb durch Art. 8 ÜVerfBesG ein neuer Satz 2 in § 173 eingefügt. Er soll den Rechtsschutz gegen überlange Gerichtsverfahren im Verwaltungsprozess durch eine der VwGO angepasste Anwendung der neu geschaffenen §§ 198, 200 f GVG sicherstellen. Damit ist der deutsche Gesetzgeber – wenn auch verspätet – der „Pilotentscheidung“ des EGMR vom 2.9.2010[21] nachgekommen, die den deutschen Gesetzgeber verpflichtete, einen Rechtsbehelf vorzusehen, der dem Erfordernis eines zeitgerechten Rechtsschutzes in der durch Art. 6 Abs. 1, 13 EMRK gebotenen Weise Rechnung trägt. Für die Beurteilung, ob eine unangemessene Verfahrensdauer iSd § 198 Abs. 1 S. 1 GVG vorliegt, kommt es grundsätzlich auf das Gesamtverfahren an, auch wenn dieses über mehrere Instanzen oder bei verschiedenen Gerichten geführt wird[22]. Eine präventive Funktionkommt insoweit der in § 198 Abs. 3 GVG geregelten Verzögerungsrügezu, deren Erhebung eine grundsätzliche Voraussetzung für die Geltendmachung eines Entschädigungsanspruchs ist. Dem repressiven gerichtlichen Rechtsschutzdienen die beim Eintritt eines Schadens nach näherer Maßgabe des § 198 Abs. 1 und 2 GVG bestehenden Entschädigungsansprüche, die einen Ausgleichsowohl des materiellen wie auch des immateriellen Schadenszum Gegenstand haben und eine Ausprägung des Aufopferungsgedankens darstellen ( BVerwG , BeckRS 2013, 56027, Rn 54; Schenke , DVBl. 2016, 745 ff; aA Reiter , NJW 2015, 2554 ff). Entgangener Gewinn ist nicht zu ersetzen ( BVerwG , NVwZ-RR 2018, 400, 402). Die Zuerkennung eines Entschädigungsanspruchs kann mit einer Feststellung der Unangemessenheit der Verfahrensdauer einhergehen (§ 198 Abs. 4 GVG). Eine solche Feststellungsklage kann nach freilich umstrittener Ansicht aber auch selbständig erhoben werden[23]. Zuständigfür entsprechende Klagen ist bei Verzögerungen durch das VG und das OVG das OVG, bei Verzögerungen durch das BVerwG das BVerwG[24].
Читать дальше