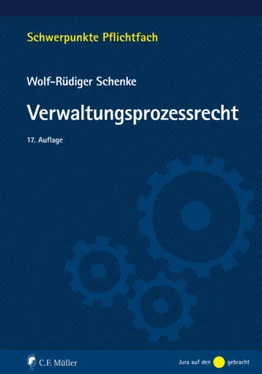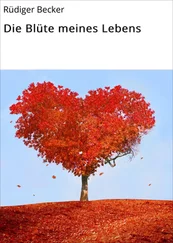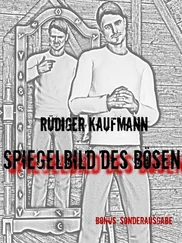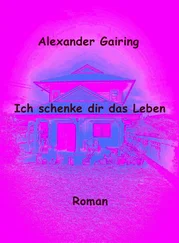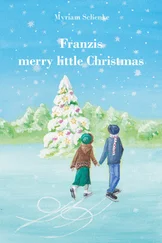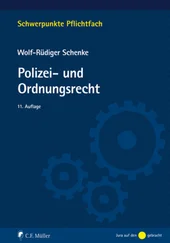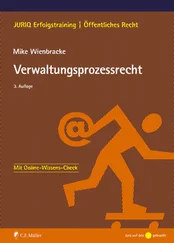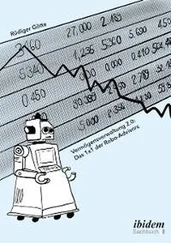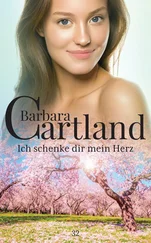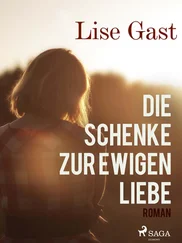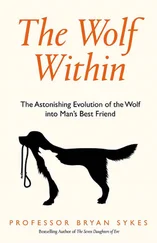62
Im Hinblick auf den im verwaltungsgerichtlichen Verfahren geltenden Untersuchungsgrundsatz sind, anders als im Zivilprozess, Versäumnisurteile unzulässig(s. § 102 Abs. 2). Dagegen sind Verzichts- und Anerkenntnisurteilegem. § 173 iVm §§ 306 f ZPO jedenfalls nicht generell ausgeschlossen (vgl oben Rn 22).
c) Form, Inhalt und Aufbau eines Urteils
63
§ 117 enthält die wesentlichen Bestimmungen zu Form, Inhalt und Aufbau eines Urteils. Nach Abs. 2 gliedert es sich in die Teile Urteilskopf bzw Rubrum (§ 117 Abs. 2 Nr 1, 2), Tenor (o. Urteilsformel, Nr 3), Tatbestand (Nr 4), Entscheidungsgründe (Nr 5) und Rechtsmittelbelehrung (Nr 6).
64
An den Urteilskopf ( Rn 65) schließt sich die Urteilsformel, der sog. Tenor, an. Er enthält die Entscheidung des Gerichts ieS. Sie besteht idR aus der Hauptsacheentscheidung(so im Beispielsfall 57c: „Die Untersagungsverfügung der Beklagten vom 2.4.2007 und der Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 2.7.2007 werden aufgehoben.“) und den Nebenentscheidungen über die Kosten, die vorläufige Vollstreckbarkeit und ggf über die Zulassung eines Rechtsmittels(Bsp. für Tenorierungen zu den verschiedenen Klagearten finden sich in Rn 872 f, 921 f, 933, 936, 939, 943, 997, 1063, 1096, 1101, 1122, 1208, Hinweise zu den Nebenentscheidungen in Rn 896[36]).
Der Tenor muss grundsätzlich aus sich heraus und unabhängig vom übrigen Inhalt des Urteils verständlich sein. Dies gilt uneingeschränkt jedenfalls für das der Klage stattgebende Urteil. Die Rechtskraft des klageabweisenden Urteils („Die Klage wird abgewiesen“[37]) erschließt sich hingegen erst unter Zuhilfenahme der Gründe. Unklarheiten, die eine zweifelsfreie Auslegung nicht zulassen, führen zur Unwirksamkeit des Urteils[38].
65
Muster eines Urteilskopfes(Anfechtungsklage gem. § 42 Abs. 1)[39]
| Az.: 5 K 0815/20 VERWALTUNGSGERICHTKARLSRUHE |
| Im Namen des Volkes Urteil In der Verwaltungsrechtssache |
| Firma Schlampig & Co. KG Marktstraße 10–16, 76555 Musterdorf prozessbevollmächtigt: Rechtsanwalt Kühn Sternstr. 12, Karlsruhe |
|
– Klägerin – |
|
gegen |
| die Stadt Musterdorf vertreten durch den Oberbürgermeister, 76555 Musterdorf prozessbevollmächtigt: Rechtsanwälte X u. Partner Musterstraße 1, Karlsruhe |
|
– Beklagte – |
|
wegen |
| gewerberechtlicher Untersagungsverfügung hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 17. Dezember 2020 durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht A, die Richter am Verwaltungsgericht B und C sowie die ehrenamtlichen Richter D und E am 17. Dezember 2020 für Rechterkannt: |
66
Der sich an den Tenor anschließende Tatbestand[40] enthält gem. § 117 Abs. 3 eine gedrängte Darstellung des Sach- und Streitstandes, also des „Sachverhalts“. Die Gliederung des Tatbestands – wie auch andere formale Kriterien beim Urteil – ist nur in begrenztem Umfang durch das Gesetz vorgegeben, sodass in der Praxis regionale Unterschiede hinsichtlich Form und Aufbau bestehen. Meist empfiehlt sich ein Einleitungssatz, der den Gegenstand des Verfahrens grob umschreibt. Dieser Satz soll erkennen lassen, worum gestritten wird. Danach folgt der unstreitige Teil des Sachverhalts, der aus dem Vortrag der Beteiligten, den Akten und den Ermittlungen des Gerichts zu gewinnen ist. Diese Darstellung erfolgt im Präsens. Daran schließt sich im Imperfekt ein Bericht über das Verwaltungsverfahren an. Dabei ist auch – kurz – die wesentliche Begründung der Verwaltungsentscheidungen zu nennen. Anschließend wird im Perfekt die Prozessgeschichte (Klageerhebung, Wiedergabe des Streitstands mit Anträgen und Vortrag von Kläger und Beklagtem, Hinweis auf Beweiserhebungen, Beiladungen etc) dargestellt. Zum Abschluss enthält der Tatbestand idR noch einen Verweis auf den Inhalt der beigezogenen Akten und Schriftsätze der Beteiligten.
67
Die auf den Tatbestand folgenden Entscheidungsgründe(beim Beschluss „Gründe“) müssen gem. § 108 Abs. 1 S. 2 die Gründe wiedergeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind. Im Aufbau unterscheidet sich der hier verwendete Urteilsstil vom für das 1. Staatsexamen maßgeblichen Gutachtenstil im Wesentlichen dadurch, dass zunächst jeweils das Ergebnis genannt wird und die Begründung nachfolgt. Allgemeingültige Angaben zu Inhalt und Aufbau der Begründung lassen sich kaum machen. Es kann lediglich darauf verwiesen werden, dass die Begründung alle tatsächlichen und rechtlichen Fragen behandeln muss, auf die es bei der Entscheidung ankam. Mehr als ein Gebot der Höflichkeit ist es auch, auf die (Rechts-)Ausführungen der Beteiligten einzugehen. Nur auf diese Weise kann das Gericht nämlich deutlich machen, dass es die Ausführungen zur Kenntnis genommen hat.
68
Das Urteil wird abgeschlossen durch die Rechtsmittelbelehrung(§ 117 Abs. 2 Nr 6) und die Unterschriften der Richter(§ 117 Abs. 1 S. 2).
§ 1 Einführung› V. Elektronische Datenverarbeitung und Verwaltungsgerichtsbarkeit
V. Elektronische Datenverarbeitung und Verwaltungsgerichtsbarkeit
69
Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche hat auch vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit[41] keinen Halt gemacht und zu entsprechenden Regelungen in §§ 55a ff geführt. Deren heutige Fassung gilt seit dem 1.1.2018. § 55a regelt die elektronische Kommunikation[42]. Danach können vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen der Beteiligten sowie schriftlich einzureichende Auskünfte, Aussagen, Gutachten, Übersetzungen und Erklärungen Dritter nach Maßgabe des § 55a Abs. 2 bis 6 als elektronische Dokumente eingereicht werden. Darunter fallen insbesondere auch Prozesshandlungen wie die Erhebung einer Klage (s. Rn 85). Die Gerichte sind seit dem 1.1.2018 verpflichtet, Vorrichtungen zum Empfang elektronischer Dokumente bereitzuhalten. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein (§ 55a Abs. 2 S. 1). Die Bundesregierung hat auf der Basis des § 55a Abs. 2 S. 2 durch eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen normiert. Sie werden in der Elektronischen-Rechtsverkehrsverordnung (ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl I 2017, 3803 ff) geregelt. Das elektronische Dokument muss nach § 55a Abs. 3 mit einer qualifizierten elektronischen Signaturder verantwortenden Partei versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg(s. zu den sicheren Übermittlungswegen § 55a Abs. 4 Nrn 1 bis 4) eingereicht werden. Eine einfache E-Mail ohne Nutzung sicherer Übertragungswege genügt danach für eine wirksame Klageerhebung nicht. Ein elektronisches Dokument ist nach § 55a Abs. 5 S. 1 eingegangen, sobald es auf der für den Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts gespeichert ist.
70
§ 55b sieht die elektronische Aktenführung in der Verwaltungsgerichtsbarkeitvor[43]. Sie steht allerdings gem. § 55b Abs. 1 S. 2 zunächst unter dem Vorbehalt entsprechender Rechtsverordnungen der Bundesregierung und der Landesregierungen, in denen jeweils für ihren Bereich der Zeitpunkt bestimmt wird, von dem an die Prozessakten elektronisch geführt werden. § 55b Abs. 2 S. 1 schreibt vor, dass ab dem 1.1.2026 die Prozessakten elektronisch geführt werden müssen. Zur Vermeidung von Medienbrüchen und des Entstehens von Hybridakten trifft § 55b Abs. 2 bis 6 nähere Regelungen. So ordnet § 55b Abs. 2 an, dass von einem elektronischen Dokument grds ein Ausdruck für die Akten zu fertigen ist, wenn die Akten in Papierform geführt werden. § 55b richtet sich nur an die Gerichte. Eine elektronische Aktenführungspflicht für Beteiligte oder Dritte wird hierdurch nicht begründet. Für Rechtsanwälte, Behörden und vertretungsberechtigte Personensieht § 55d vor, dass sie ab 1.1.2022 ihre Dokumente grds elektronisch einzureichen haben. Werden die Prozessakten elektronisch geführt, regelt § 100 Abs. 2 S. 1, dass den Beteiligten Akteneinsichtbezüglich der Gerichtsakten und der dem Gericht vorgelegten Akten durch Bereitstellung zum Abruf gewährtwird. Richterliche Entscheidungen durch Computer zu ersetzen,scheitert nicht nur an den technischen Voraussetzungen, die jedenfalls derzeit fehlen, sondern wäre auch im Falle einer gesetzlichen Zulassung mit Art. 19 Abs. 4 GG unvereinbar[44]. Zur Zulässigkeit einer elektronischen Bekanntgabe einer untergesetzlichen Norm s. Rn 986. Zur Notwendigkeit einer Rechtsbehelfsbelehrung in Bezug auf die Möglichkeit zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen s. Rn 726 und Rn 767; zu der wegen der Corona-Epidemie häufiger genutzten Möglichkeit einer Digitalisierung der mündlichen Verhandlung durch § 102a (dazu Karge , NVwZ 2020, 926 ff), der eine Videokonferenz erlaubt, s. Rn 33.
Читать дальше