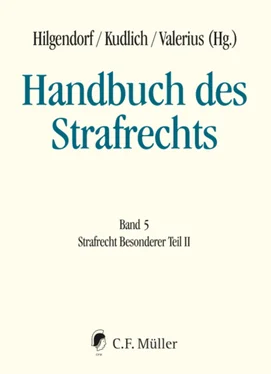7
Wegen der Erweiterung des Anwendungsbereichs der actio vi bonorum raptorum war rapina eine „widerrechtliche, gewaltsame Entziehung fremden beweglichen Eigenthums, um sich dasselbe zuzueignen“[23], sodass es damit im römischen Recht durchaus einen mit dem heutigen Tatbestand vergleichbaren „ einfachen Raub“ gab,[24] der nicht mehr durch spezielle Begehungsmerkmale oder -umstände gekennzeichnet war. Wenngleich sich damit eine gewisse Verselbstständigung andeutet, ist es aber fraglich, ob diese Weiterentwicklung der ediktischen Klage den Schluss auf eine systematische Eigenständigkeit des Raubes rechtfertigt, denn der raptor haftete nach der actio furti , also gleich einem Dieb. Die immer noch bestehende Nähe des Raubes zum Diebstahl zeigt sich u.a. auch daran, dass Räuber immer noch als „ fures atrociores “ („schreckliche Diebe“) bezeichnet wurden.[25]
8
Dass sich keine strikte dogmatische Unterscheidung zwischen Diebstahl und Raub im römischen Rechtentwickelt hat, zeigt sich weiterhin in einigen in den Institutionen bestehenden Unklarkeiten. Eine Unterscheidung beider Delikte hätte insbesondere am Merkmal „Gewalt“ erfolgen können, wodurch der Raub durch als „gewaltsame Wegnahme“ gegenüber dem „normalen Diebstahl“ eine systematische Eigenständigkeit erlangt hätte. Eine solchermaßen klare Abgrenzung scheint aber nicht vorgenommen worden zu sein. Bei der Lektüre römischer Rechtstexte fällt auf, dass bei Ausführungen zum Diebstahl ( furtum ) und zum Raub ( rapina ), etwa in den Institutionen des Iustinian , neben der gewaltsamen auch die beim Diebstahl heimliche Begehung eine Rolle spielt.[26] Problematisch ist hierbei, dass die Kriterien „Heimlichkeit“ und „Gewalt“ auch parallel, „[o]hne strenge Gegensatzbildung“ verwendet wurden.[27] Dies lag vor allem daran, dass die „Abgrenzung zum Raub, Definition und Worterklärung […] beim furtum nicht parallel [liefen]“[28], sondern dass das eine Kriterium etwa als Definitionsmerkmal verwendet wurde, das Definitionskriterium jedoch nicht zwingend das Abgrenzungskriterium darstellte – anders als heute, wo nach unserem Verständnis eine Definition gerade eine präzise Abgrenzung von anderen (wiederum definierten und definierbaren) Termini ermöglichen soll. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Römer, die ja einzelne Klagearten und nicht einzelne Tatbestände unterschieden, eine systematische Trennung von Raub und Diebstahl gar nicht vor Augen hatten.
9
Die entscheidende Weichenstellung erfolgte wohl erst später durch die Glossatoren: Diese orientierten sich an der antiken Worterklärung von „ furtum “, das von „ furvus “ (schwarz, dunkel, finster) abgeleitet wurde, und brachten damit den Diebstahl mit einer nächtlichen, heimlichen Begehungsweise in Verbindung, während der Raub durch Gewalt definiert sei.[29] Insbesondere die „Glossa ordinaria schafft[e] […] die Grundlage späterer Lehren: Der Raub wird durch das Merkmal der Gewalt charakterisiert“[30]. Daher sei er auch als „das schwerere Delikt und strenger zu bestrafen, nicht weil es offen, sondern weil es mit Gewalt geschieht.“[31] Somit hat sich im römischen Recht eine Verselbstständigung des Raubes gegenüber dem Diebstahl wohl nicht vollzogen, sondern wurde erst im Nachhinein durch die Glossatoren angestrebt, wo eine „Gegenüberstellung von heimlicher Wegnahme bei furtum und gewaltsamem Vorgehen bei rapina “ erfolgte.[32]
III. Das germanische Recht
10
Von besonderem Interesse gerade aus deutscher Sicht ist die Rechtsentwicklung ab der germanisch-fränkischen Zeit. Erst mit dem 3. Jahrhundert n.Chr., mit der Völkerwanderung, treten die germanischen Stämme nachhaltig in die abendländische Geschichte ein.[33] Erkenntnisse über das Rechtsverständnis der Germanen[34] lassen sich insbesondere aus deren Rechtsaufzeichnungen, den seit dem 6. Jahrhundert aufgezeichneten germanischen Stammesrechten ( leges barbarorum ), gewinnen.[35]
11
Das germanische Stammesrechtist hierbei wesentlich durch die Begriffe der Fehde und der Versühnung sowie der Sippeals der grundlegenden rechtlichen sowie sozialen Einheit zu charakterisieren.[36] Verwirklichte ein Germane gegenüber einem anderen freien Germanen ein Delikt, war dies eine Kränkung der gesamten Sippe des Opfers.[37]Auf diese Verletzung der Sippenehre wurde mit der sog. Fehde reagiert,[38] die ihrerseits eine „offene Kampfansage an die Sippe [!] des Täters“[39] darstellte und der Art nach auch Raubhandlungen miteinschließen konnte.[40] Da die Verteidigung der Ehre zumeist einen größeren Personenkreis betraf und den Widerstand der Fehdegegner hervorrief, konnten Fehdehandlungen über eine lange Dauer hinweg fortgeführt werden, was nicht selten in regelrechten Fehdekriegen mündete.[41] Aus diesem Grund bestand ein großes Interesse an der alternativ zur Fehde möglichen Versühnung: Mit einer Vereinbarung von Ausgleichszahlungen konnten bestehende Fehden beendet werden bzw. auf diese verzichtet werden.[42] Hierfür wurde in den germanischen Stammesrechten ein Kompositionensystem(von lat. compositio ) festgelegt, welches für Vermögensbeeinträchtigungen, Verletzungen und Tötung Bußsätze vorsah, deren Höhe für die Opferseite einen ehrmäßig akzeptablen Richtwert darstellen sollten.[43] Auch das Delikt des Raubes findet sich in den Bußkatalogen, etwa im Edictum Rothari, einer Gesetzessammlung des Langobardenkönigs Rothari von 643. Hierbei ist etwa für den Straßenraub eine Buße von 20 solidi (1 solidus = 1 Schilling)[44] vorgesehen, im Falle eines Blutraubes bzw. Raubmords ist neben dem Wergeld eine Buße von 80 solidi zu zahlen[45], eine immens hohe Summe, vergleicht man diesen Betrag mit dem Bußsatz der fränkischen Königsbannbuße (60 solidi)[46].
12
Neben den germanischen Rechtsbüchern,[47] sind die seit dem 13. Jahrhundert entstandenen Rechtsbücher[48] eine zentrale Quelle für die Beschäftigung mit dem germanischen bzw. germanisch-deutschen Recht. Durch das Aufkommen der Städte seit dem 12. Jahrhundert entstanden zahlreiche Rechtssammlungen in Form von Stadtrechten, in die auch das örtliche Gewohnheitsrecht einfloss. „Zum Kernbestand der Stadtrechte […] gehören von Anfang an auch strafrechtliche Regelungen, die den Stadtfrieden sichern.“[49] Mit dem Aufkommen dieser neuen Rechtsquellen ging das Bedürfnis nach der Aufzeichnung des Rechts einher. Bei diesen Aufzeichnungen handelt es sich jedoch keineswegs um staatlich angeordnete Kodifikationen, sondern vielmehr um private Rechtssammlungen, sog. „Rechtsbücher“[50] oder „Rechtsspiegel“[51]. Größte Bedeutung kommt hierbei dem sog. Sachsenspiegel, der zwischen 1220 und 1235 von dem sächsischen Adligen Eike von Repgow aufgezeichnet wurde,[52] sowie dem später zusammengestellten Schwabenspiegel(ca. 1275) zu.
2. Die Verklärung des „germanischen Rechts“ im 19. Jahrhundert
13
Wie oben bereits ausgeführt ( Rn. 3), stellt sich bei der Beschäftigung mit der geschichtlichen Entwicklung des Raubes insbesondere die Frage nach einer sich nach und nach herausbildenden Eigenständigkeit des Tatbestandes. Eine besondere Relevanz erhielt diese Frage nach einer klaren, von anderen Delikten abgrenzbaren Tatbestandsformulierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Im Zuge der zu dieser Zeit aufkommenden Strafzweckdiskussion bemühte man sich um „eine Präzisierung der Tatbestände mit eindeutigen Merkmalen und klaren Abgrenzungen“.[53] Zudem herrschte angesichts des aufkommenden nationalen Bewusstseins ein verstärktes Bestreben nach einer Kodifikation des Strafrechts.[54] Dies erforderte auch die Herausarbeitung eines eigenen nationalen Rechts.[55] Hierzu suchte man insbesondere nach Abgrenzungsmerkmalen zwischen deutschem und römischem Recht, um so eine „typisch germanische“ Tatbestandsformulierung zu entwickeln.
Читать дальше