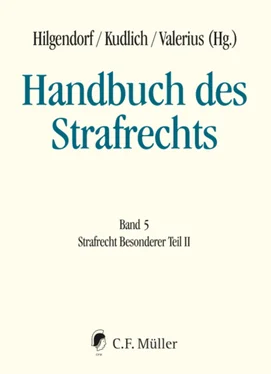20
Neben dem Tatbestandsmerkmal der Gewalt stellt sich auch die Frage, „inwieweit auch Drohungen den Tatbestand des Raubes erfüllen“[95] konnten. Diese Frage war schon zu Zeiten der gemeinrechtlichen Autoren problematisch,[96] Böhmer führte die (wohl auf Carpzov zurückgehende) Differenzierung zwischen vis absoluta und vis compulsiva fort.[97] Im ALR findet sich hierzu § 1188 ALR: „Auch schon derjenige, welcher einen Diebstahl ohne wirkliche Gewalt, jedoch unter Androhung gefährlicher Behandlung ausübt, hat als Räuber eine acht- bis zehnjährige Festungsstrafe, nebst Züchtigung am Anfange und Ende der Strafzeit, verwirkt.“
21
Ein für uns interessanter, an dieser Stelle kurz zu nennender, Aspekt ergibt sich aus einem Vergleich von § 1188 ALR mit § 1255 ALR. In § 1255 ALRfindet sich der Tatbestand der concussio : „Ist jemand durch Concussion genöthiget worden, Gelder oder Sachen ohne Vergeltung zu geben: so ist eine dergleichen Erpressung, nach Maaßgabe der dazu gebrauchten Mittel, gleich einem Diebstahle oder Raube zu bestrafen.“ Hierbei zeigt sich, dass auch das ALR für den Raub und die räuberische Erpressung verschiedene Tatbestände bereithielt und diese Unterscheidung offensichtlich „nach dem Kriterium ‚Nehmen oder Geben‘“[98] erfolgte.
3. Bayerisches Strafgesetzbuch (1813)
22
In Art. 233 des Bayerischen StGB von 1813wird der Raubtatbestand folgendermaßen formuliert: „Wer, um eine Entwendung zu vollbringen, einer Person Gewalt anthut, entweder durch thätliche Mißhandlungen oder durch Drohung auf Leib und Leben, der ist des Raubes schuldig, er habe seine habsüchtigen Absichten erreicht oder nicht.“[99] War noch im ALR unklar, wie der Gewaltbegriff beschaffen sein sollte, nahm das Bayerische StGB eine Ausdifferenzierung dergestalt vor, dass hierunter „thätliche Mißhandlungen“ oder „Drohung auf Leib und Leben“ zu verstehen ist. Im Hinblick auf die heutige Fassung des Raubtatbestandes ist dies bereits deshalb bemerkenswert, da ausdrücklich zwischen Gewalt und Drohung unterschieden wird und sich Letztere gerade nicht mehr als Unterfall des Gewaltmerkmals einordnen lässt. Eine weitere entscheidende Veränderung erfuhr der Tatbestand durch den Passus „um eine Entwendung zu vollbringen“. Für Landmesser markiert dieser Zusatz eine wichtige Entwicklungsstufe des Raubtatbestandes, da das Bayerische StGB anders als das ALR nun „den Raub nicht mehr als gewalttätige Entwendung oder Entwendung durch Gewalt an der Person, sondern als Gewalt an der Person zum Zwecke der Entwendung [beschreibt].“[100] Dementsprechend stellte das Bayerische StGB auch andere Anforderungen an die Vollendung des Raubtatbestandes. Maßgeblich für die Verwirklichung des Delikts war danach allein die Zufügung von Gewalt gegen eine Person, die in Entwendungsabsicht verübt werden musste. Folglich galt der Raub unabhängig von einer tatsächlich erfolgten Wegnahme als vollendet.
23
Von besonderem Interesse ist aus heutiger Sicht auch hier die Abgrenzung von Raub und Erpressung. Das Bayerische StGB unterscheidet zwei Erpressungstatbestände, Art. 241 und Art. 242.[101] Während sich Art. 241 auf eine Erpressung im Zusammenhang mit Rechtsgeschäften oder Schulderlass bezieht, schließt Art. 242 auch die Sacherpressung mit ein.[102] Neben den Bezugspunkten der Erpressungstatbestände unterscheiden sich zudem die angewandten Erpressungsmittel.[103] Während Art. 241 sich auf das Raubmittel der Gewalt bezieht („thätliche Mißhandlung“), spricht Art. 242 von der Drohung mit „künftiger Mißhandlung“, wodurch deutlich wird, dass das Bayerische StGB lediglich eine Unterscheidung hinsichtlich der vom Täter angewandten Mitteln kennt, eine Unterscheidung im Hinblick auf das Verhalten des Opfers (Geben oder Nehmen) aber nicht gemacht wird.“[104]
VI. Entwicklung vom preußischen StGB (1851) bis 1945
24
Der heute gültige Tatbestand des Raubes kristallisierte sich erst Mitte des 19. Jahrhundertsheraus, als auch die Drohungsalternative auf Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr gegen Leib oder Leben beschränkt wurde,[105] wobei als ein für die Strafrechtsentwicklung entscheidender Schritt das Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten von 1851 angesehen wird. So ist wohl Vogel zu verstehen, wenn er ausführt: „[Der] Durchbruch zum modernen Recht gelang mit dem preuß. StGB 1851 über Raub und Erpressung.“[106] Der Raubtatbestand wurde im preußischen StGB in § 230wie folgt formuliert: „Einen Raub begeht, wer mit Gewalt gegen eine Person, oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben, eine fremde bewegliche Sache einem Anderen in der Absicht wegnimmt, sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen.“[107] Als schweren Raub qualifizierte dabei § 232 den Raub mit Waffen, Banden und den Straßenraub, § 233 sah für den Raub mit schwerer Körperverletzung oder Todesfolge lebenslange Freiheitsstrafe vor.[108]
25
Das preußische StGB enthielt damit im Wesentlichen die heutige Fassung des Raubtatbestandes.[109] Gleichzeitig diente es als Vorläufer des Strafgesetzbuches des Norddeutschen Bundes, das als Reichsstrafgesetzbuch[110] vom 1. Januar 1872 an im gesamten Reich galt und mit dem das Deutsche Reich damit ein einheitliches Strafgesetzbuch erhielt.[111] Der Raubtatbestandwar in § 249 RStGBdabei im zwanzigsten Abschnitt wie folgt formuliert: „Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem Anderen in der Absicht wegnimmt, sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen, wird wegen Raubes mit Zuchthaus bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter sechs Monaten ein.“[112] Die in § 250 RStGB geregelten Raubqualifikationenfassten dabei die §§ 232, 233 des prStGB 1851 zusammen und fügte den Raub zur Nachtzeit in einem bewohnten Gebäude hinzu.[113] Nach § 251 RStGBwurde der Räuber mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft, wenn beim Raub „ein Mensch gemartert oder durch die gegen ihn verübte Gewalt eine schwere Körperverletzung oder der Tod desselben verursacht worden ist“. Mit „Gewalt“ war die Gewalt zur Überwindung von Widerstand gegen die Wegnahme gemeint.[114] Für den qualifizierenden Erfolg hatte der Täter stets einzustehen („objektive Erfolgshaftung“).[115]
26
Betrachtet man die reformgeschichtliche Entwicklung des Raubtatbestandes seit Einführung des RStGB von 1871, so sind dessen „Grundzüge […] im Großen und Ganzen bis heute beibehalten worden.“[116] So erfuhr der Tatbestand des § 249 RStGB während des Kaiserreichs und der Weimarer Republikkeine Änderungen.[117] Zentraler Gegenstand juristischer Diskussionen war vielmehr das Verhältnis von Raub und (räuberischer) Erpressung, im Zuge derer verschiedene Reformvorschläge für das RStGB entwickelt wurden.[118] So wurde etwa vorgeschlagen, Raub und räuberische Besitzerpressung durch den Passus „wegnimmt und abnötigt“ in einem einheitlichen Tatbestand zusammenzufassen.[119]
27
Auch zur Zeit des Nationalsozialismuserfuhr der Raubtatbestand selbst keine Änderungen.[120] Anders der Strafrahmen. Die Verordnung gegen Gewaltverbrecher vom 5. Dezember 1939[121] („Gewaltverbrecherverordnung“) ermöglichte eine „Aufstockung“ von Raubdelikten zur sog. Gewaltverbrechertat, welche die Todesstrafe als Rechtsfolge vorsah. Tatbestandsvoraussetzung des § 1 Gewaltverbrecherverordnung war das Vorliegen bestimmter Ausführungsmodalitäten;[122] daneben bildete die Einordung des Täters als „Gewaltverbrecher“ ein ausschlaggebendes Strafbarkeitskriterium.[123] Hierin zeigt sich beispielhaft die im Nationalsozialismus übliche Anwendung der Tätertypenlehre.[124]
Читать дальше