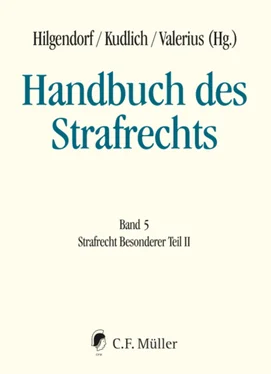b)Versuch, Vollendung und Beendigung102 – 108
aa)Versuch102 – 106
(1) Allgemein102
(2) Tatentschluss103
(3) Unmittelbares Ansetzen104, 105
(4) Rücktritt vom Versuch106
bb) Vollendung und Beendigung107, 108
c)Konkurrenzen und Wahlfeststellung109 – 113
aa) Konkurrenzverhältnis zu §§ 253, 255 StGB109
bb) Konkurrenzverhältnis zu §§ 242 ff. StGB und §§ 240 f. StGB110, 111
cc) Idealkonkurrenz112
dd) Wahlfeststellung113
d) Rechtsfolgen, minder schwerer Fall114 – 116
III.Besonderheiten des schweren Raubes (§ 250 StGB)117 – 152
1. Allgemeine Fragen117 – 119
2.Raubqualifikationen nach § 250 Abs. 1 StGB120 – 131
a) Raub durch Beisichführen von Waffen oder anderen gefährlichen Werkzeugen (§ 250 Abs. 1 Nr. 1a StGB)120 – 122
b) Raub mit sonstigen Werkzeugen oder Mitteln (§ 250 Abs. 1 Nr. 1b StGB)123, 124
c) Raub mit Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung (§ 250 Abs. 1 Nr. 1c StGB)125 – 130
d) Bandenraub (§ 250 Abs. 1 Nr. 2 StGB)131
3.Raubqualifikationen nach § 250 Abs. 2 StGB132 – 140
a)Verwendung von Waffen oder gefährlichen Werkzeugen (§ 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB)132 – 135
aa) Vorbemerkung132, 133
bb) Waffe134
cc) Gefährliches Werkzeug135
b) Bandenraub mit Waffen (§ 250 Abs. 2 Nr. 2 StGB)136
c) Raub unter schwerer körperlicher Misshandlung (§ 250 Abs. 2 Nr. 3a StGB)137 – 139
d) Lebensgefährdender Raub (§ 250 Abs. 2 Nr. 3b StGB)140
4. Täterschaft und Teilnahme141 – 143
5. Versuch und Rücktritt144
6.Rechtsfolgen145 – 147
a) Regelstrafrahmen145
b) Minder schwerer Fall (§ 250 Abs. 3 StGB)146, 147
7.Konkurrenzen148 – 152
a) Innertatbestandliche Konkurrenzen148 – 150
b) Verhältnis zu anderen Raubdelikten151
c) Sonstige Konkurrenzen152
IV.Raub mit Todesfolge153 – 166
1. Allgemein153
2. Grunddelikt154
3. Qualifizierende Folge155
4. Kausalität, objektive Zurechnung und gefahrspezifischer Zusammenhang156 – 158
5. Subjektive Voraussetzungen159, 160
6. Täterschaft und Teilnahme161, 162
7. Versuch und Rücktritt163, 164
8. Rechtsfolgen165
9. Konkurrenzen166
E. Rechtsvergleich167 – 175
I. Ausgestaltung des Raubtatbestandes168 – 173
II. Verhältnis des Raubes zu anderen Delikten174, 175
F. Strafverfahrensrecht176 – 178
Ausgewählte Literatur
8. Abschnitt: Schutz des Vermögens› § 30 Raub› A. Einführung
1
Im zwanzigsten Abschnitt des Strafgesetzbuches sind die – praktisch besonders relevanten – Delikte zusammengefasst, bei denen der Täter Vermögenverschiebungen unter Einsatz von Nötigungsmitteln bewirkt. Während es sich bei den Erpressungsdelikten (§§ 253, 255 StGB) um Straftatbestände mit Selbstschädigungscharakter handelt, ist der Raub ein Fremdschädigungsdelikt, der zudem – ebenfalls anders als die Erpressungsdelikte – nur die Verletzung des Eigentums erfasst. Der Raub gehört zu den „klassischen“ Vermögensdelikten und ist seit dem Altertum fester Bestandteil des (staatlichen) Strafrechts. Der heute im Strafgesetzbuch geregelte Grundtatbestand des § 249 StGB, der den Einsatz qualifizierter Nötigungsmittel zur Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache erfordert, vereinigt Nötigungs- und Diebstahlselemente. Der Qualifikationstatbestand des § 250 StGB weist in Teilen Ähnlichkeit zu § 244 StGB auf. Eine Erfolgsqualifikation des Raubes enthält § 251 StGB (Raub mit Todesfolge).
8. Abschnitt: Schutz des Vermögens› § 30 Raub› B. Historische Bezüge
B. Historische Bezüge
I. Das griechische und talmudische Recht
2
Der Raub galt bereits in frühen Rechtskreisenals eine zu bestrafende Handlung.[1] So steht in der Bibel: „Du sollst Deinem Nächsten nicht unrecht tun, noch ihn berauben“.[2] Ebenso findet sich im griechischen und talmudischen Recht das Delikt des Raubes.[3] Dabei wurde nach talmudischem Recht der „Dieb strenger als der Räuber bestraft, weil jener die Menschen mehr fürchtet als Gott“[4]. Letzteres ist wohl so zu verstehen, dass der Dieb zwar der Entdeckung durch die Menschen entgehen will (heimliche Tat), der Umstand, dass Gott ihn bei seiner Tat sieht, ihn jedoch nicht vom Diebstahl abhält; somit fürchtet er die Entdeckung des Diebstahls durch die Menschen mehr als durch Gott und ist daher schwerer zu bestrafen.
3
Bei der Betrachtung der rechtshistorischen Entwicklung des Raubtatbestandesist es aus heutiger Sicht auch von Interesse, ob bzw. ab wann der Raubtatbestand nicht mehr nur als Unterfall des Diebstahls angesehen, sondern als eigenständiges Delikt ( delictum sui generis ) behandelt wurde. Hierfür ist auch eine Auseinandersetzung mit der Abgrenzung von Raub und Diebstahl notwendig.
4
Der Raub ( rapina , in kriegerischen Zusammenhängen auch praeda oder spolium genannt) war, anders als im heutigen Recht, ursprünglich nicht als ein eigenständiges Delikt ausgestaltet, sondern wurde als ein Unterfall des Diebstahls ( furtum ) verstanden, dessen Tatbestand „[…] das Ansichnehmen einer beweglichen im Eigenthum stehenden Sache zu eigener Bereicherung und zum Schaden eines Dritten“ umfasste und damit so weit gefasst war, dass er auf eine Vielzahl von deliktischen Handlungen angewendet werden konnte.[5] Da der Raub auch nach römischem Recht durch die Anwendung von Gewalt gekennzeichnet war, galt er somit als ein gewaltsamer Diebstahl.[6]
5
Eine wichtige Entwicklungsstufe im römischen Recht war das Edikt des Prätors M. Lucullus (76 v. Chr.).[7] In diesem war für besondere Begehungsformen der gewaltsamen (also „räuberischen“) Eigentumsentziehung eine spezielle Klage, die actio vi bonorum raptorum , vorgesehen.[8] Durch die Einführung dieser Klage begann sich die unmittelbare Verbindung von Raub und Diebstahl etwas zu lösen; der Raub erhielt eine Art „eigenständigen Charakter“.[9]Jedoch war der Anwendungsbereich der Klage auf eine bestimmte Begehungsart begrenzt: Sie erfasste ausschließlich den Fall der vorsätzlichen Wegnahme mit Waffengewalt durch eine Vielzahl von zusammen agierenden Menschen ( hominibus armatis coactisque ).[10] Dieser enge Anwendungsbereich hatte, wie Cicero schreibt, vorwiegend politische Gründe: Die gewaltsamen Zustände des römischen Bürgerkrieges, in denen Angriffe auf fremdes Eigentum durch Beschädigung oder Raub Überhand zu nehmen drohten, machten die Einführung dieser gesonderten Klage erforderlich.[11] Der Räuber haftete wie bei der actio furti und hatte dem Geschädigten – sofern dieser innerhalb der prätorischen Jahresfrist klagte – nicht nur den einfachen, sondern den vierfachen Wert der geraubten Sache zu ersetzen ( quadruplum ).[12] Die Geltendmachung des zugefügten Schadens durch den Geschädigten war hier somit untrennbar mit einer Sanktionierung des Räubers durch die Multiplarstrafe verknüpft.[13]
6
Im Laufe der Kaiserzeiterfuhr dieses Edikt zahlreiche Anpassungen, die zur weiteren Entwicklung des Raubes beitrugen. Entscheidend war, dass der Anwendungsbereich nun nicht mehr nur auf den Fall der hominibus armatis coactisque beschränkt blieb. So konnte ein Raub nun auch ohne Waffengewalt ( armati ) begangen werden.[14] Ebenso war aufgrund einer späteren Interpretation des Edikts die Begehung durch mehrere ( hominibus coactis ) nicht mehr eine zwingende Voraussetzung für die Anwendung der Klage.[15] Nunmehr konnte auch die Begehung durch einen Einzelnen einen Raub darstellen.[16] Darüber hinaus wurde der Anwendungsbereich des Raubes durch neue, beispielhafte Begehungsformen (sog. „ crimina extraordinaria “[17]), die eine Wegnahme zu einem Raub machten, erweitert. Zu nennen sind hier vor allem der Raub unter Ausnutzung besonderer Umstände wie einer Feuersbrunst oder eines Schiffbruchs[18] sowie Straßenraub durch Wegelagerer,[19] sog. „ grassatores “[20], oder Raubmord[21] („ latrocinium “[22]).
Читать дальше