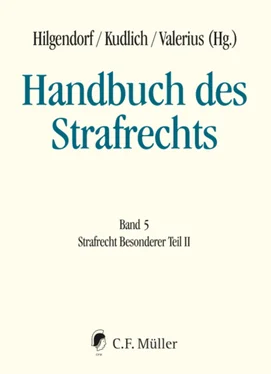[21]
Lieberwirth , Stichwort „Diebstahl“, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. I, 2008, Sp. 1048.
[22]
Lieberwirth , Stichwort „Diebstahl“, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. I, 2008, Sp. 1048.
[23]
Haas , Maiwald-FS, S. 145, 156; Das Handhaftverfahren schrieb vor, dass der Betroffene unmittelbar nach der Tötung des Diebes ein Gerüft (Hilfeschrei) erheben musste. Daraufhin herbeieilende Rechtsgenossen ( Schreimannen ) sollten später durch Eid die Rechtmäßigkeit der Tötung vor Gericht bestätigen, ausf. hierzu Albrecht , Das Festnahmerecht Jedermanns nach § 127 Abs. 1 StPO, 1970, S. 20.
[24]
Albrecht , Das Festnahmerecht Jedermanns nach § 127 Abs. 1 StPO, 1970, S. 21.
[25]
Belegstellen hierzu finden sich bei Wilda , Das Strafrecht der Germanen, 1842, S. 890, Fn. 3, 4, 5; Niederländer , Die Entwicklung des furtum und seine etymologischen Ableitungen, 1950, S. 220, Fn. 131.
[26]
Haas , Maiwald-FS, S. 145, 156.
[27]
Albrecht , Das Festnahmerecht Jedermanns nach § 127 Abs. 1 StPO, 1970, S. 21, 23. In einer altwestphälischen Gerichtsordnung heißt es zur Aussagekraft der Handhaftigkeit (vgl. Wigand , Das Femgericht Westfalens, 1893, S. 406.): „Man spricht, man soll Niemaand ohne Urtheil tödten; das ist wahr, es sind aber Sachen, die von Natur ihr Urtheil eingeschlossen in sich tragen, als habende Hand, gichtiger Mund und blickender Schein.“
[28]
Als Vorbild für die CCC diente die Bambergische Peinliche Halsgerichtsordnung ( Bambergensis ) von 1507. Viele Vorschriften innerhalb der CCC wurden fast wortidentisch übernommen, s. hierzu Geppert , Jura 2015, 143, 145 f.
[29]
Geppert , Jura 2015, 143, 143.
[30]
Geppert , Jura 2015, 143, 143, 150.
[31]
Albrecht , Das Festnahmerecht Jedermanns nach § 127 Abs. 1 StPO, 1970, S. 35.
[32]
Heimlicher und offener Diebstahl wurden in die Kategorie des einfachen Diebstahls gefasst, wobei nochmals zwischen kleinem und großem Diebstahl unterschieden wurde. Diese Differenzierung war für die Strafe von Relevanz, s. Lieberwirth , Stichwort „Diebstahl“, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. I, 2008, Sp. 1048.
[33]
Kohlheyer , Rechtsgedanke des § 252 StGB, S. 38 f.; Klien , Revision der Grundsätze über das Verbrechen des Diebstahls, 1807, S. 486 stellte dazu fest: „[…] die Strafe des gefährlichen Diebstahls und Raubes [hängt] nicht von dem Wesen dieses oder jenes Verbrechens an sich betrachtet, sondern vielmehr davon ab, ob den einen oder dem anderen viel oder wenig Gewalt verübt, ob jener oder dieser durch eine Rotte oder einzelne Personen unternommen worden ist.“
[34]
Feuerbach , Lehrbuch, 1847, S. 572.
[35]
Kohlheyer , Rechtsgedanke des § 252 StGB, S. 39.
[36]
Klien , Revision der Grundsätze über das Verbrechen des Diebstahls, 1807, S. 486.
[37]
Klien , Revision der Grundsätze über das Verbrechen des Diebstahls, 1807, S. 486.
[38]
Lask , Das Verbrechen des räuberischen Diebstahls, S. 27, 29; weitere gedankliche Vorarbeiten finden sich insb. bei Tittmann , Handbuch der Strafrechtswissenschaft und der deutschen Strafgesetzeskunde, 2. Bd., 1823, S. 435 ff.
[39]
Albrecht , Das Festnahmerecht Jedermanns nach § 127 Abs. 1 StPO, 1970, S. 38.
[40]
Kohlheyer , Rechtsgedanke des § 252 StGB, S. 38.
[41]
Rüping/Jerouschek , Grundriss, Rn. 219.
[42]
Lask , Das Verbrechen des räuberischen Diebstahls, S. 29 f.
[43]
Haas , Maiwald-FS, S. 145, 163.
[44]
Kohlheyer , Rechtsgedanke des § 252 StGB, S. 42.
[45]
Ein detaillierter Überblick zu der inhaltlichen Ausgestaltung der Reformentwürfe der Jahre 1822, 1827, 1831 und 1854 findet sich bei Kohlheyer , Rechtsgedanke des § 252 StGB, S. 43 f.
[46]
Kohlheyer , Rechtsgedanke des § 252 StGB, S. 44.
[47]
Kohlheyer , Rechtsgedanke des § 252 StGB, S. 45.
[48]
Kohlheyer , Rechtsgedanke des § 252 StGB, S. 45.
[49]
Haas , Maiwald-FS, S. 145, 164.
[50]
Goltdammer , Die Materialien zum Strafgesetzbuche für die preußischen Staaten, 1852, S. 516, Fn. 1.
[51]
Zu den historischen Hintergründen Schmidt , Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 1965, S. 315 f.
[52]
Regge (Hrsg.), Quellen zur preußischen Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts, Gesetzesrevision (1825-1848), Bd. 2, 1982, S. 525.
[53]
Regge (Hrsg.), Quellen zur preußischen Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts, Gesetzesrevision (1825-1848), Bd. 3, 1984, S. 87.
[54]
Schubert (Hrsg.), Quellen zur preußischen Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts, Gesetzesrevision (1825-1848), Bd. 5, 1994, S. 73.
[55]
Kohlheyer , Rechtsgedanke des § 252 StGB, S. 44; Goltdammer , Die Materialien zum Strafgesetzbuche für die preußischen Staaten, 1852, S. 516 f.
[56]
Goltdammer , Die Materialien zum Strafgesetzbuche für die preußischen Staaten, 1852, S. 516.
[57]
Schubert/Regge (Hrsg.), Quellen zur preußischen Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts, Gesetzesrevision (1825-1848), Bd. 6, 1996, S. 55. In diesem Entwurf wurde erstmals die Formulierung des räuberischen Diebstahls in seiner heute gültigen Form verwendet.
[58]
Genauere Ausführungen zu den wechselnden Reformentwürfen finden sich bei Haas , Maiwald-FS, S. 145, 165.
[59]
Perron , GA 1989, 145, 164.
[60]
Goltdammer , Die Materialien zum Strafgesetzbuche für die preußischen Staaten, 1852, S. 516.
[61]
Haas , Maiwald-FS, S. 145, 165.
[62]
Lask , Das Verbrechen des räuberischen Diebstahls, S. 37.
[63]
Im Detail hierzu Kohlheyer , Rechtsgedanke des § 252 StGB, S. 58 ff.
[64]
Niedzwicki , ZJS 2004, 371, 371.
[65]
Beispielhaft für die propagandistische Autobahnrhetorik Freisler , DJ 1939, 34, 34: „Und der Führer baute etwas, was es in dieser Art bisher nirgends gab – die Reichsautobahnen.“
[66]
Meurer-Meichsner , Untersuchungen zum Gelegenheitsgesetz, S. 23; Hübsch , Der Begriff des Angriffs, S. 19.
[67]
Freisler , DJ 1939, 34, 34.
[68]
Vgl. Niedzwicki , ZJS 2004, 371, 371, Fn. 4; dies geht auch aus den Vorbemerkungen der Schriftleitung der Zeitschrift „Deutsches Strafrecht“ zu einem Aufsatz v. Gemmingens „Über Grundgedanken und Tragweite des Autofallengesetzes“ hervor, in dem es heißt (DStrR 1939, 1, 4): „[…] der Autofallensteller [vergreift] […] sich an der für Deutschland wirtschaftlich erforderlichen Motorisierung des Verkehrs.“
[69]
Gruchmann , Justiz im Dritten Reich 1933-1940, 2009, S. 897.
[70]
Niedzwicki , ZJS 2004, 371, 372.
[71]
RGBl. I, S. 723.
[72]
Gruchmann , Justiz im Dritten Reich 1933-1940, 2009, S. 897 f. § 1 Nr. 1 des Gesetzes lautete: „Mit dem Tode oder, soweit nicht bisher eine schwerere Strafe angedroht ist, mit lebenslangem Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren wird bestraft, wer es unternimmt, einen Richter oder einen Staatsanwalt oder einen mit Aufgaben der politischen Kriminal-, Bahn-, Forst-, Schutz- oder Sicherheitspolizei betrauten Beamten oder einen Angehörigen der Wehrmacht oder der Sturmabteilung (einschließlich des Stahlhelms) […] aus politischen Beweggründen oder wegen ihrer amtlichen oder dienstlichen Tätigkeit zu töten, oder wer zu einer solchen Tötung auffordert, sich erbietet, ein solches Erbieten annimmt oder eine solche Tötung mit einem anderen verabredet.“
Читать дальше