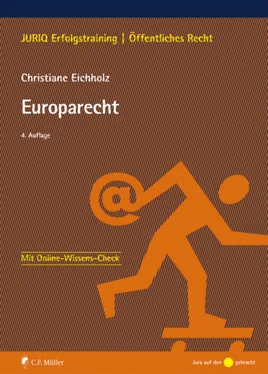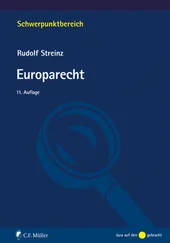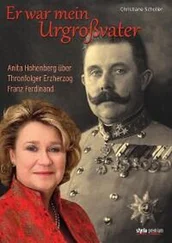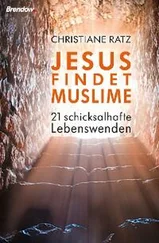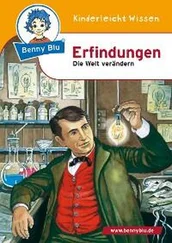79

Nicht klar war lange Zeit, ob es nach Auffassung des BVerfG auch einen Anwendungsvorrang vor dem nationalen Verfassungsrecht des GG geben sollte. Seit 1986 erkennt das BVerfG jedoch an, dass der Grundrechtsschutzauf Unionsebene durch die EuGH -Rechtsprechung mit dem des GG vergleichbar ist.[5] In dem Urteil zum Vertrag von Maastricht[6] hat das BVerfG festgestellt, dass es seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von Unionsrecht in Deutschland in einem Kooperationsverhältnis zum EuGH ausübt. Das BVerfG könne sich auf eine Prüfung der generellen Gewährleistung der unabdingbaren Grundrechtsstandards beschränken, da der EuGH für das gesamte Gebiet der Europäischen Union den Grundrechtsschutz garantiere.
3. Teil Der Anwendungs- oder Geltungsvorrang des Unionsrechts› B. Der Anwendungsvorrang› II. Die Begründung des EuGH zum Anwendungsvorrang des unmittelbar anwendbaren Unionsrechts
II. Die Begründung des EuGH zum Anwendungsvorrang des unmittelbar anwendbaren Unionsrechts
80
Der EuGH leitete[7] den Vorrang des Unionsrechts aus der notwendigen Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Unionsrechts ab. Die Mitgliedstaaten hätten durch die Gründung bzw. den späteren Beitritt zur EG ihre Souveränitätsrechte freiwillig beschränkt, damit die EG selbst für die Mitgliedstaaten verbindlich handeln könne. Soweit die Mitgliedstaaten ihre Kompetenzen auf die EG übertragen hätten, sei die EG als supranationale Organisation zuständig.
81

Aufgrund der freiwilligen Beschränkung der Souveränitätsrechte besteht nach Auffassung des EuGH zwangsläufig auch ein Vorrang des Unionsrechts vor dem nationalen Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten.
Aus der Simmenthal-II-Entscheidung[8]
. . . dass jeder im Rahmen seiner Zuständigkeit angerufene staatliche Richter verpflichtet ist, das Gemeinschaftsrecht uneingeschränkt anzuwenden und die Rechte, die es dem Einzelnen verleiht, zu schützen, indem er jede möglicherweise entgegenstehende Bestimmung des nationalen Rechts, gleichgültig, ob sie früher oder später als die Gemeinschaftsnorm ergangen ist, unangewendet lässt. . .
Der EuGH erteilte in der zuvor zitierten Entscheidung jedem nationalen Richter die Befugnis, selbständig die Vereinbarkeit des nationalen Rechts mit dem unmittelbar anwendbaren Unionsrecht zu überprüfen und bei widersprüchlichem nationalen Recht dieses nicht anzuwenden.
[1]
Thiele Europarecht S. 123; Karpenstein Praxis des EG-Rechts Rn. 87.
[2]
EuGH EuZW 1999, 405 (Ciola).
[3]
Thiele Europarecht S. 123 f.
[4]
BVerfGE 73, 339 (Solange-II-Beschluss).
[5]
BVerfGE 73, 339 (Solange-II-Beschluss).
[6]
BVerfGE 89, 155 (Maastricht-Entscheidung).
[7]
EuGH Slg 1964, 1251 (1270) COSTA-E.N.E.L.
[8]
EuGH Slg.1978, 629 (Simmenthal-II).
3. Teil Der Anwendungs- oder Geltungsvorrang des Unionsrechts› C. Der Geltungsvorrang
82
Soweit ein Widerspruch zwischen dem nationalen Recht und dem unmittelbar anwendbaren Unionsrecht besteht, ist bei der Annahme eines Geltungsvorrangs das nationale Recht nichtig. Wird beim Anwendungsvorrang nur die Anwendbarkeit einer nationalen Norm bei einem konkreten Widerspruch mit einer unmittelbar anwendbaren Unionsrechtsnorm ausgeschlossen, kann diese nationale Norm aber bei einem rein innerstaatlichen Sachverhalt durchaus zur Anwendung kommen. Wäre die nationale Norm aber nichtig aufgrund des Widerspruchs zur unmittelbar anwendbaren Unionsrechtsnorm, wäre sie überhaupt nicht mehr anwendbar.[1] Der Geltungsvorrang wird weder vom EuGH noch vom BVerfG und auch nicht von großen Teilen des Schrifttums vertreten.
[1]
Arndt/Fischer/Fetzer Europarecht S. 93.
4. Teil Quellen des Unionsrechts
Inhaltsverzeichnis
A. Das Primärrecht
B. Die völkerrechtlichen Verträge
C. Das Sekundärrecht
D. Sekundärrechtliche Normen im Bereich der GASP, im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und des Datenschutzrechts
83
Hinweis
Zwischen dem Primärrecht, den völkerrechtlichen Verträgen und dem Sekundärrecht besteht eine Normenhierarchie. Das Sekundärrecht darf dem Primärrecht und den völkerrechtlichen Verträgen, die völkerrechtlichen Verträge dürfen dem Primärrecht nicht widersprechen.
4. Teil Quellen des Unionsrechts› A. Das Primärrecht
84
Das Primärrechtbesteht aus unterschiedlichen Rechtsquellen.[1]
Zum Primärrecht gehören
| • |
die Gründungsverträge, |
| • |
die Protokolle, Anhänge und Erklärungen, |
| • |
die allgemeinen Rechtsgrundsätzeund |
| • |
das Gewohnheitsrecht. |
4. Teil Quellen des Unionsrechts› A. Das Primärrecht› I. Die Gründungsverträge
85
Wiederholen Sie zur unmittelbaren Anwendbarkeit die Darstellung in Rn. 73–75.
Zu den Gründungsverträgen gehören:
| • |
der AEUV, EUV und der EAV,[2] |
| • |
die EEA, |
| • |
der Vertrag von Maastricht, |
| • |
der Vertrag von Amsterdam, |
| • |
der Vertrag von Nizza, |
| • |
der Vertrag von Lissabon, |
| • |
die Beitrittsverträgemit allen nach der Gründung beigetretenen Mitgliedstaaten. |
Die Gründungsverträgeregeln überwiegend die Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaftsorgane. Nur ausnahmsweise können einzelne Bestimmungen der Gründungsverträge unmittelbar Rechte und Pflichten für natürliche oder juristische Personen begründen.[3] Eine einzelne Bestimmung aus den Gründungsverträgen muss dann im konkreten Fall unmittelbar anwendbar sein.
86
Der EuGH [4] hatte u.a. folgende Bestimmungen des EGV für unmittelbar anwendbar erklärt, sodass bzgl. dieser Normen nicht mehr im konkreten Fall geprüft werden muss, ob die Voraussetzungen der unmittelbaren Anwendbarkeit vorliegen:
Unmittelbar anwendbar sind:
| • |
Art. 18 AEUV (Diskriminierungsverbot) |
| • |
Art. 28–37 AEUV (Warenverkehrsfreiheit) |
| • |
Art. 45–55 AEUV (Personenverkehrsfreiheit) |
| • |
Art. 56–62 AEUV (Dienstleistungsfreiheit) |
| • |
Art. 63–66 AEUV (Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit) |
| • |
sowie Art. 101, 102, 108 Abs. 3, 110 Abs. 1 und Abs. 2 und 157 AEUV. |
4. Teil Quellen des Unionsrechts› A. Das Primärrecht› II. Die Protokolle, Anhänge und Erklärungen
II. Die Protokolle, Anhänge und Erklärungen
87
In Art. 51 EUV werden die Protokolleund Anhängeder Verträge zu Bestandteilen der Verträge erklärt. In diesen Protokollen werden Ausnahmen von vertraglichen Regelungen für einzelne Mitgliedstaaten erfasst und Konkretisierungen des Vertragstextes vorgenommen. Die rechtlich verbindlichen Protokolle binden grundsätzlich nur die EU-Organe und die mit dem Vollzug des Unionsrechts betrauten staatlichen Organe. Sie gelten aber auch im Verhältnis zwischen dem Bürger und dem jeweiligen Mitgliedstaat, wenn sie die Voraussetzung der unmittelbaren Anwendbarkeit erfüllen.[5]
Читать дальше