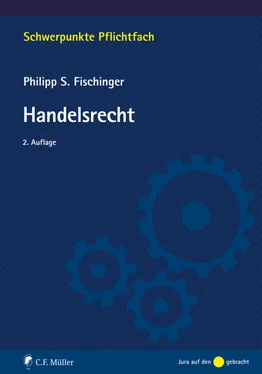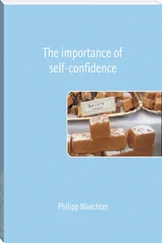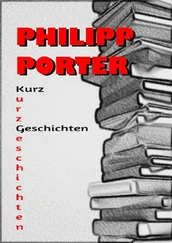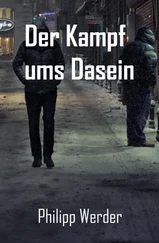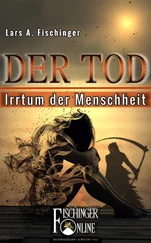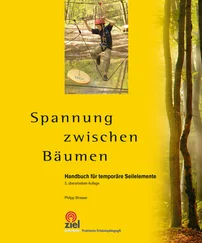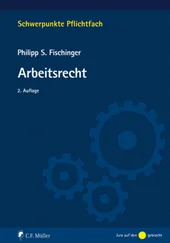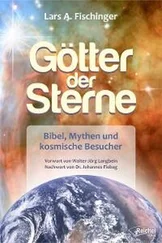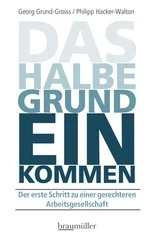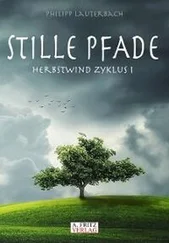28
Sind die Voraussetzungen von § 1 II HGB erfüllt, ist der Gewerbetreibende zwingend Kaufmann, auf eine Eintragung im Handelsregister kommt es hierfür nicht an. Es handelt sich um einen sog. Istkaufmannoder Musskaufmann(im Gegensatz zu den Kannkaufleuten der §§ 2, 3 HGB).
§ 2 Kaufleute, §§ 1-7 HGB› B. Istkaufmann, § 1 HGB › II. Tatbestandsvoraussetzungen des § 1 II HGB
II. Tatbestandsvoraussetzungen des § 1 II HGB
29
Gewerbe ist jede (a) selbstständige, (b) planmäßige, auf eine gewisse Dauer angelegte, (c) nach außen gerichtete, marktorientierte, (d) entgeltliche und (e) nicht freiberufliche Tätigkeit. Im Einzelnen:
30
Kaufmann kann nur sein, wer selbstständig tätig ist. Subsumtionsfähige Kriterien für die Abgrenzung liefert § 84 I 2 HGB, wonach selbstständig ist, wer im Wesentlichen seine Tätigkeit frei gestaltenund seine Arbeitszeitbestimmen kann, also insbesondere keinem Weisungsrecht unterliegt und in keine fremde Arbeitsorganisation eingebunden ist. Maßgeblich sind die gesamten Umstände des konkreten Einzelfalles. Gemessen an § 84 I 2 HGB scheiden insbesondere Arbeitnehmer und Beamte aus. Aber auch die Geschäftsführung einer AG oder GmbH ist keine selbstständige, sondern angestellte Tätigkeit.[2]
31
Entscheidend ist allein die rechtlicheSelbstständigkeit, eine wirtschaftliche Abhängigkeit z. B. von einem Auftraggeber oder einer Bank ändert mithin nichts an der Kaufmannseigenschaft.[3] Anders als andere Rechtsgebiete (z. B. das Sozialrecht) kennt das Handelsrecht also nicht die Kategorie des Scheinselbstständigen.[4] Überdies schadet es für das Vorliegen der Kaufmannseigenschaft nicht, wenn der Handelnde vorwiegend im fremden Namen tätig wird (z. B. Handelsvertreter, § 84 HGB).
32
Die Tätigkeit muss planmäßig erfolgen, d. h. auf eine gewisse Dauer angelegt und auf eine Vielzahl von Geschäften ausgerichtet sein.[5] Allzu streng dürfen diese Merkmale aber nicht gehandhabt werden. So schadet z. B. weder eine regelmäßige Unterbrechung der Tätigkeit (z. B. Betrieb eines Würstchenstandes nur auf dem Weihnachtsmarkt) noch die Ausübung nur über einen überschaubaren Zeitraum (z. B. Verkauf auf einer Messe). Ausgenommensind hingegen vereinzelte Geschäfte (z. B. einmaliger Verkauf von Haushaltsgerümpel auf einem Flohmarkt). Abgrenzungsschwierigkeiten können sich bei ebay-Verkäufern ergeben; maßgeblich sind die Umstände des Einzelfalls.[6]
c) Tätigkeit nach außen (Marktorientierung)
33
Der Betrieb eines Gewerbes kann nur bei einer offenen, nach außen gerichteten Tätigkeit angenommen werden. Die bloße Verwaltung eigenen Vermögens im Privatbereich durch Börsenspekulationen ist ebenso wenig erfasst, wie die bloße Bedarfsdeckung.[7] Bei der Vermietung und Verpachtung von Wohn- und Geschäftsräumen rekurriert die Rechtsprechung darauf, ob es sich um eine bloße Kapitalanlage (kein Gewerbe) handelt oder ob der Umfang jenseits der üblichen Haushaltsführung liegt (dann Gewerbe).[8]
d) Entgeltlichkeit/Tätigkeit am Markt
34
Unabhängig von der noch zu erörternden Frage (s. Rn. 44), ob der Gewerbebegriff eine Gewinnerzielungsabsicht voraussetzt, ist jedenfalls – wie auch § 354 I HGB zeigt (vgl. auch Rn. 566 ff.) – eine entgeltliche Tätigkeit am Markt konstitutives Merkmal des Gewerbebegriffs. Kaufmann ist daher nur, wer für die ihm angebotenen Leistungen/Waren ein Entgelt (in welcher Form auch immer) erwartet. An der Entgeltlichkeit fehltes zum einen bei rein karitativen Tätigkeiten wie z. B. dem Sammeln von Spenden für Erdbebenopfer, zum anderen bei öffentlich-rechtlichem Tätigwerden gegen Gebühren; etwas anderes gilt aber, wenn die öffentliche Hand wie ein Privater am Geschäftsverkehr teilnimmt.[9]
e) Keine freiberufliche, wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit
35
Als negatives Tatbestandsmerkmal des Gewerbebegriffs darf es sich nicht um eine wissenschaftliche, künstlerische oder freiberufliche Tätigkeit handeln.[10] Diese Ausnahmen sind historisch begründet und knüpfen an das (veraltete?) Ideal an, diesen Tätigkeiten werde nicht zur „schnöden“ Gewinnerzielung nachgegangen, sondern zur Erreichung „höherer“ wissenschaftlicher oder künstlerischer Interessen.[11] Der maßgebliche Unterschied zwischen einem Handelsgewerbe und einer freiberuflichen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Tätigkeit wird darin gesehen, dass es sich bei Ersterem um eine organisierte Wirtschaftseinheit handelt, die auf einer Kumulation von Produktionsmitteln beruht, wohingegen bei Letzterer eine ausgeprägte Kreativität der Tätigkeitund die höchstpersönliche Leistungim Vordergrund steht.[12]
36
Schon kraft Gesetzes keinen Gewerbebetriebbetreiben z. B. Rechtsanwälte (§ 2 BRAO), Patentanwälte (§ 2 II Pat-AnwO), Notare (§ 2 S. 3 BNotO) und Ärzte (§ 1 II BundesÄO). Überdies wird eine Reihe von Berufen von der h.M. als freiberuflich eingestuft, so z. B. Wissenschaftler, Architekten, Unternehmensberater, Schriftsteller, Opernsänger und Schauspieler sowie Bildhauer und Kunstmaler.[13] Umgekehrt sind keine FreiberuflerApotheker (vgl. § 8 ApoG) sowie z. B. Krankengymnasten, Auktionatoren, Zahntechniker, Fahrlehrer, Repetitoren, Restaurateure und Werbeberater;[14] sie betreiben – sofern die übrigen Voraussetzungen von § 1 II HGB erfüllt sind – also ein Handelsgewerbe. Umstrittenist, ob Privatlehrer, Dolmetscher, Übersetzer, Sachverständige und Journalisten Freiberufler sind.[15] In Zweifelsfällen kann in der Klausur § 1 II PartGGals „Daumenregel“ für die Kategorisierung als freier Beruf herangezogen werden.
37
In Fall 1 kommt eine Eintragung des A als Kaufmann nicht in Betracht, da es sich bei der Tätigkeit eines Architekten nach h.M. um eine freiberufliche Tätigkeit handelt. Weil es damit am Betrieb eines Gewerbes überhaupt fehlt, kann A nicht nur nicht Istkaufmann (§ 1 HGB) sein, sondern auch nicht durch freiwillige Eintragung nach § 2 HGB (Kann-)Kaufmann werden.
38
Umfasst die Tätigkeit sowohl gewerbliche wie freiberufliche Elemente, so kommt es auf den Schwerpunkt der Tätigkeitan. Entsprechend kann eine Tätigkeit, die eigentlich im Kern eine freiberufliche darstellt, doch als Gewerbe anzusehen sein. Dies ist anzunehmen, wenn die die Tätigkeit prägende höchstpersönliche, kreative Arbeitsweise gegenüber dem Einsatz von Produktionsmitteln zurücktritt (z. B. ein Arzt betreibt ein Wellness-Hotel oder ein Rechtsanwalt ein juristisches Repetitorium).
39
Zu beachten ist, dass auch Freiberufler Unternehmer i. S. v. § 14 BGBsind. Während also jeder Kaufmann i. S. d. HGB zugleich Unternehmer i. S. v. § 14 BGB ist, ist nicht jeder Unternehmer in diesem Sinne auch Kaufmann (s. auch Rn. 4).
f) Umstrittene Kriterien
aa) Erlaubtheit der Tätigkeit?
40
Ein Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriftenwie z. B. die GewO, das GastG oder die HandwO hindert die Annahme eines Gewerbes nicht, § 7 HGB; die dadurch bewirkte Trennung des Handelsrechts von öffentlich-rechtlichen Vorschriften erleichtert den kaufmännischen Verkehr durch Schaffung von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit bei der Anwendbarkeit des HGB.[16] Ob im Übrigen die Erlaubtheit der Tätigkeit Voraussetzung für das Vorliegen eines Gewerbes ist, ist umstritten, insbesondere soweit es um Verstöße gegen §§ 134, 138 BGB geht. Richtigerweise ist die Erlaubtheit der Tätigkeit keineVoraussetzung für den Gewerbebegriff.[17] Das folgt zum einen aus der Wertung des § 7 HGB sowie zum anderen daraus, dass andernfalls die kaufmännischen Grundpflichten nicht anwendbar wären.[18] Da Prostitution spätestens seit Inkraftreten des ProstG nicht mehr sittenwidrig ist,[19] kann ein Bordellbetrieb unabhängig von diesem Meinungsstreit Handelsgewerbe sein.[20]
Читать дальше