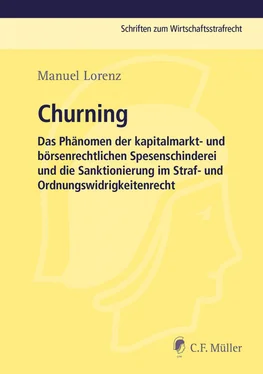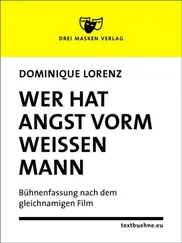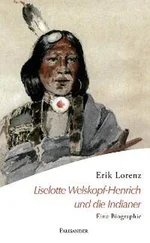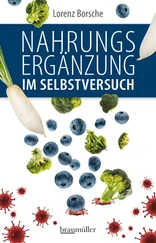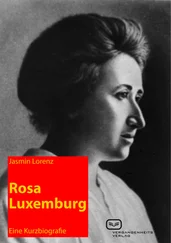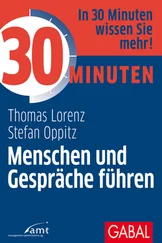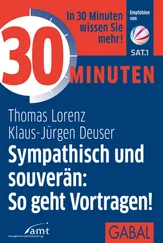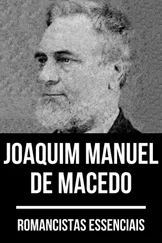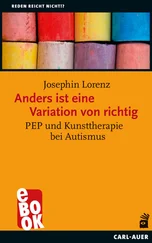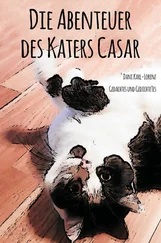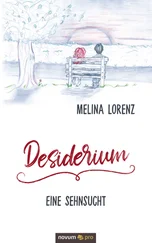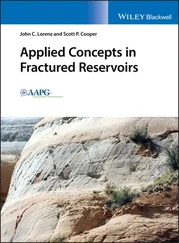Einleitung und Begriff des Churning
„ Das Glück ist eine leichte Dirne,
Und weilt nicht gern am selben Ort […]“[1]
1
Dieser Vers kann insbesondere auf Börsenspekulationsgeschäfte uneingeschränkt Geltung beanspruchen, sind Spekulationsgewinne doch leider meist „wie gewonnen, so zerronnen“. Nicht in jedem Falle aber sind Gewinne und Verluste Resultate des Treibens von Bulle und Bär. Oft ist es auch – um im Tierreich zu bleiben – schlicht ein schwarzes Schaf gewesen.
2
In den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts etablierte sich in Deutschland abermals der mit Schließung der letzten Rohstoffterminbörse 1971 in Bremen wenige Jahrzehnte vorher in der Bundesrepublik eingestellte Warenterminhandel.[2] So nahmen 1998 gleich mehrere Terminbörsen ihre Arbeit auf. Beispielhaft sei EUREX, seit 2012 ein Unternehmen der Deutsche Börse Group, genannt, die im September 1998 aus der Fusion der im Januar 1990 gegründeten Deutsche Terminbörse (DTB) und der zur SWX Swiss Exchange gehörenden Swiss Options and Financial Futures Exchange AG (SOFFEX) hervorging. Die Warenterminbörse Hannover nahm ihre Arbeit im April 1998 auf und fusionierte mit der Dekrebo München zur Risk Management Exchange (RMX), deren Börsenterminhandel im August 2009 wieder eingestellt und an die EUREX nach Frankfurt am Main verlegt wurde. Als letztes sei die European Energy Exchange (EEX) mit Sitz in Leipzig genannt, die einen Marktplatz für Energie und energienahe Produkte bietet und im Jahre 2002 aus einer Fusion der Leipzig Power Exchange (LPX) und der European Energy Exchange (EEX) mit Sitz in Frankfurt a. M. hervorgegangen ist.
3
Die erneute Etablierung des Warenterminhandels in der Bundesrepublik Deutschland ging einher mit einer Vielzahl von Gesetzesnovellierungen, die einzig oder zumindest auch zu diesem Zwecke initiiert wurden. So lag der Börsenrechtsreform von 1989 zum Beispiel die Motivation zugrunde, die Voraussetzung zur Schaffung der Deutschen Terminbörse und „notwendigen Rahmenbedingungen für einen effizienten und volumenstarken Handel“ an selbiger sowie einen funktionierenden Terminmarkt im Allgemeinen zu schaffen.[3] Dies sollte unter anderem durch die Änderung des § 53 BörsG a.F. dahingehend geschehen, dass die Börsentermingeschäftsfähigkeit kraft Information eingeführt und mithin der Termin- sowie Differenzeinwand eingeschränkt wurden.[4] Die Börsentermingeschäftsfähigkeit kraft Information ergänzte die statusorientierte, also die an die Kaufmannseigenschaft anknüpfende Börsentermingeschäftsfähigkeit.[5] Bis dahin war es nämlich ausschließlich möglich, wirksame und rechtlich durchsetzbare Kontrakte zwischen Kaufmännern zu schließen. Mit dieser Novellierung konnten aber nun Privatanleger börsengeschäftsfähig werden, wenn sie schriftlich über die Bedingungen und die spezifischen Risiken des Geschäfts informiert wurden.[6] Nur wenn diese Informierung des Privatanlegers ausblieb, konnte er noch etwaigen Forderungen aus dem Geschäft mit dem Termineinwand begegnen, §§ 52, 55 BörsG a.F.[7] „Der mündige Bürger […] [wurde] damit in die Lage versetzt, seine wirtschaftlichen Dispositionen uneingeschränkt in eigener Verantwortung zu tätigen, wenn ihm bei seinen Dispositionen ausreichende Erkenntnismöglichkeiten und Entscheidungsgrundlagen an die Hand gegeben wurden“[8]. Mit der dadurch bedingten Öffnung des Terminmarktes für Privatpersonen trat dann auch die gewünschte Reaktion, nämlich die Zunahme von Termingeschäften unter Beteiligung von Privatanlegern, ein.[9] Die Möglichkeit der Börsengeschäftsfähigkeit kraft Information des § 52 Abs. 2 BörsG a.F. bestand gemäß § 52 Abs. 3 BörsG a.F. aber nicht für den Warenterminhandel, wiederum mit Ausnahme von Edelmetallen.[10] Dies war wohl Folge dessen, dass mit der Börsengesetznovelle von 1989 vorrangig die Voraussetzungen der DTB geschaffen werden sollten. Aber auch mit der DTB gab es noch keinen Warenterminhandel in der Bundesrepublik, weshalb mit dieser Regelung wohl einzig der ausländische Warenterminhandel diskriminiert wurde.[11] Privatanlegern blieb deshalb nur die Teilnahme am ausländischen Warenterminhandel.[12]
4
Mit Streichung der §§ 50-70 BörsG a.F. durch das Vierte Finanzmarktförderungsgesetz[13] von 2002, das selbige Ziele wie die Börsengesetznovelle von 1989 und jenes verfolgte, die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland im europäischen Kontext und innerhalb der global vernetzten Finanzmärkte weiter zu stärken, wurden die Börsentermingeschäftsfähigkeit kraft Information wieder als „international unüblich und kompliziert“ abgeschafft und die terminrechtlichen Bestimmungen in das Wertpapierhandelsgesetz verlagert, welches durch das Zweite Finanzmarktförderungsgesetz[14] von 1994 neu geschaffen wurde.[15] Privatanleger konnten Verbindlichkeiten aus dem Börsentermingeschäft nunmehr überhaupt nicht mehr mit dem Termin- respektive Differenzeinwand begegnen, wenn sie nicht kraft beruflicher Qualifikation oder Information die Börsentermingeschäftsfähigkeit erlangt hatten,[16] was entscheidend für die Stellung des deutschen Börsenterminmarktes im internationalen Vergleich war. Aufklärungspflichtverletzungen vermögen nunmehr nicht mehr die Rechtswirksamkeit des Geschäfts zu beeinträchtigen, sondern können lediglich Schadensersatzansprüche zur Folge haben.[17]
5
Nicht erst durch die erneute Etablierung des Handels mit Warentermingeschäften in Deutschland kamen aber unlautere Geschäftspraktiken unter Ausnutzung börsenunerfahrener Anleger auf. Auch zuvor war es Privatanlegern ja bereits möglich, Warentermingeschäfte an ausländischen Börsen zu tätigen. Eine speziell im Warenterminbereich verankerte Vorgehensweise unredlicher Finanzdienstleister und Broker war und ist es nach wie vor, unter Ausnutzung einer erteilten Vollmacht oder faktischen Kontrolle, das Depot eines Kunden objektiv exzessiv und wirtschaftlich sinnlos, entgegen den Anlagezielen und zu Lasten der Gewinnchancen des Anlegers ausschließlich zu dem Zweck umzuschichten, das Gebührenaufkommen zu steigern. Dieses Phänomen wird gemeinhin mit dem Begriff Churning[18] etikettiert. Phänomenologisch wichtig ist, dass von Churning nicht bereits bei Vornahme eines einzelnen – also auch nicht schon beim ersten – Geschäfts gesprochen werden kann. Vielmehr vermag erst eine Gesamtheit von Geschäften das Phänomen Churning zu bilden.[19]
6
Das aus dem amerikanischen Kapitalanlagerecht stammende Lexem des Churning wird zumeist mit Provisionsschneider- oder -schinderei,[20] aber auch mit Ausplündern,[21] Kontoplünderung über Spesen,[22] Rein- und Rausschicken,[23] Drehen,[24] Wälzen,[25] Spesen- oder Gebührenreiterei,[26] Provisionsmanipulation[27] und Warenterminschwindel[28] frei übersetzt. Wörtlich übersetzt bedeutet Churning so viel wie „Buttern“[29]. Die Semasiologie entstammt der Butterherstellung, bei der die Milch so oft bewegt wird, dass die Butter abgeschöpft werden kann und ausschließlich die Magermilch zurückbleibt. In den Sinngehalt der Provisionsschinderei transferiert, steht das Ausgangsprodukt der Milch stellvertretend für das Depot des Anlegers, die entnommene Butter für die berechneten Provisionen und die letztlich verbleibende Magermilch für das reduzierte Depot.[30]
7
Bekannt wurde Churning vor allem im Zusammenhang mit Geschäften an der Warenterminbörse, ist in Deutschland aber mittlerweile sowohl bei Finanztermingeschäften als auch im Wertpapierbereich verbreitet.[31] Praktisch am häufigsten ist Churning wohl bei der Verwaltung von Anlegerkonten, aber auch bei Fonds, Pools oder Sammelkonten auszumachen.[32] Beim Churning handelt es sich nicht etwa um einen neuen (Straf-)Tatbestand, sondern um die „rechtstatsächliche Erfassung eines rechtswidrigen Sachverhalts“[33]. Aufgrund des kapitalmarkttypischen Aspekts ist Churning dem Kapitalmarktstrafrecht zuzuordnen.[34]
Читать дальше