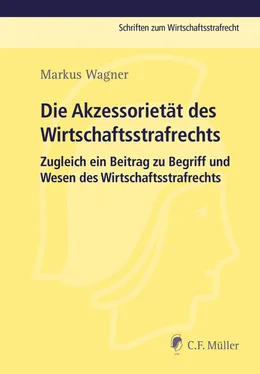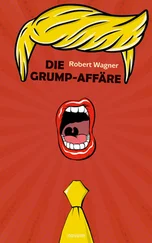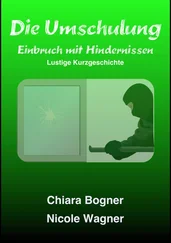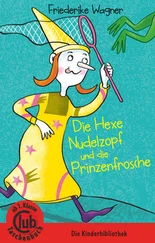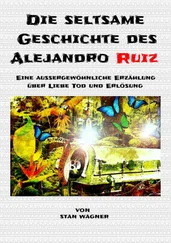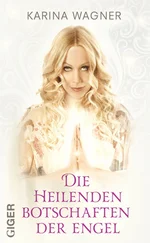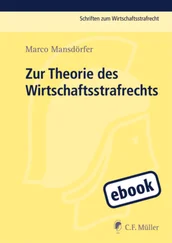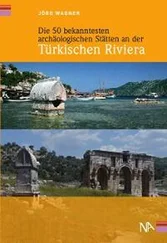Aufgrund der großen Streubreite der in Frage kommenden Phänomene mögen diese Beispiele genügen. Sie sollen in erster Linie verdeutlichen, dass es der Sache nach letztlich nur um eine negative Definition gehen kann: nicht erfasst ist lediglich all dasjenige, was bereits unter den Rechtsbegriff zu fassen ist.[11]
2. Die Akzessorietät des Rechts zur Wirklichkeit
18
Als erstes wird der Frage nach einer Akzessorietät des Rechts zur Wirklichkeit im eben genannten Sinne nachgegangen. Die Idee eines solchen Akzessorietätsverhältnisses drängt sich geradezu auf, ruft man sich Schlagwörter wie dasjenige der „wirtschaftlichen Betrachtungsweise“ ins Gedächtnis.[12] Auch wenn etwa über „sozialadäquates Verhalten“ und seine Auswirkungen auf die Strafbarkeit der betreffenden Person diskutiert wird, geht es in der Sache um nichts anderes als um die Frage, inwiefern das Recht abhängig ist von den jeweiligen gesellschaftlichen Ansichten.[13]
19
Ob ein solches Akzessorietätsverhältnis besteht, kann nicht allgemein und abstrakt untersucht werden. Vielmehr ist nach den einzelnen Lebensbereichen[14] zu differenzieren, hinsichtlich derer ein Akzessorietätsverhältnis in Betracht kommt. Zudem wird – zumindest teilweise – danach zu unterscheiden sein, in welcher Phase des Rechts nach einem Akzessorietätsverhältnis gefragt wird: in der Phase der Rechts setzungoder in der Phase der Rechts anwendung. Dies findet seine Rechtfertigung unter anderem in der Tatsache, dass die „Wirklichkeit“ sich „für den Normsetzer in einem ganz anderen Aggregatszustand als für den Normanwender“ befindet, weil der dem Rechts anwendergegenüberstehende Sachverhalt wesentlich konkreter gefasst ist als derjenige Lebensausschnitt, auf dessen Grundlage der Rechts setzersein Normgebilde baut.[15]
a) Auseinandersetzung mit möglichen Einwänden
20
Bevor diese Untersuchung im Einzelnen stattfinden kann, ist es notwendig, sich mit denkbaren Einwänden auseinanderzusetzen, die nicht nur einzelne Bereiche, sondern die These von der Akzessorietät des Rechts zur Wirklichkeit insgesamt in Frage stellen. Solche scheinen sich einerseits aus dem Blickwinkel der Systemtheorie (aa), Rn. 21 ff.), andererseits aus dem Verfassungsrecht (bb), Rn. 30 ff.) und der Rechtstheorie (cc), Rn. 34) zu ergeben.
aa) Systemtheoretische Einwände gegen eine Akzessorietät des Rechts zur Wirklichkeit
21
In der juristischen Literatur wurde in den vergangenen Jahren zunehmend die sog. „Systemtheorie“ rezipiert.[16] Dieser Strukturgedanke wurde im angloamerikanischen Bereich ursprünglich von Talcott Parsons vorangetrieben;[17] in Deutschland ist der Begriff untrennbar mit dem Namen Niklas Luhmanns verknüpft. Spätestens dessen grundlegendes Werk „Soziale Systeme“ aus dem Jahre 1984 hat die Diskussion um die Systemtheorie in Deutschland in ihrer ganzen Breite eröffnet.[18]
Die Aussagen der Systemtheorie könnten geeignet sein, der hier zugrunde gelegten These von der Akzessorietät des Rechts zur Wirklichkeit das Fundament zu entziehen. Dieser Frage ist im Folgenden nachzugehen. Hierzu müssen jedoch zunächst – wenn auch in der gebotenen Kürze – die Grundstrukturen der Systemtheorie nachgezeichnet werden:
(1) Recht als soziales System
22
Die Systemtheorie geht von der Existenz verschiedener sozialer Systeme aus.[19] Neben anderen Systemen wie etwa „Politik“ und „Wirtschaft“ steht das Rechtsystem.[20] Relativ zu jedem System besteht eine Umwelt, welche die übrigen Systeme einschließt;[21] das System „definiert“[22] sich gerade aus der Differenz zwischen System und Umwelt.[23]
23
Gegenstand der Systemtheorie sind nicht etwa Menschen als Subjekte[24] (diese werden als Bestandteil der Systemumwelt betrachtet) oder deren Handlungen, sondern ausschließlich Kommunikationen.[25] Jedes System kommuniziert dabei mittels eines spezifischen und binären Codes, der es von den anderen Systemen unterscheidet.[26] Während etwa im System der Wirtschaft dieser Code im Dualismus von „Zahlung“ und „Nicht-Zahlung“ besteht,[27] verläuft die Kommunikation im Rechtssystem über die Aussage, ob etwas „Recht“ oder „Unrecht“ ist.[28]
(2) Recht als selbstreferentielles autopoietisches System
24
Die Systemtheorie versteht das Recht als selbstreferentielles System.[29] Gemeint ist damit, dass das Recht ein (operativ) in sich geschlossenes Ganzes bildet, das mit seiner „Umwelt“ (und damit auch anderen sozialen Systemen wie Wirtschaft und Politik) nicht kommunizieren kann.[30] Nur innerhalb des Rechtssystems kann die kommunikative Entscheidung über „Recht“ oder „Unrecht“ getroffen werden. Lediglich eine kognitive Offenheit des Rechtssystems ist gegeben, die es dem Recht zwar ermöglicht, seine Umwelt zu beobachten; es kann sich aber gerade nur in seinen eigenen Kategorien ausdrücken.[31]
Aufbauend[32] auf den selbstreferentiellen Charakter des Rechtssystems ergibt sich dessen Autopoiese:[33] Aufgrund seiner Selbstreferenz ist das System in der Lage, seine eigenen Komponenten selbst zu reproduzieren.[34]
(3) Relativierungen der Autonomie des Rechtssystems
25
Eine solche Betrachtungsweise würde den Akzessorietätsgedanken auf den ersten Blick – jedenfalls in Bezug auf die Akzessorietät des Rechts zur Wirklichkeit – im Keim ersticken. Allerdings werden die soeben geschilderten Ausgangsgedanken des systemtheoretischen Ansatzes auch durch die Systemtheoretiker selbst relativiert. Die diesbezüglichen Modelle der beiden wichtigsten Vertreter der Systemtheorie in Deutschland seien im Folgenden vorgestellt:
(a) Operative und strukturelle Koppelungen (Luhmann)
26
Nach Luhmann sind – jedenfalls aus dem System des Rechts heraus – sowohl strukturelle wie auch operative Koppelungen zwischen dem (Rechts-)System und dessen Umwelt möglich:[35] Während operative Koppelungen nur in Bezug auf Einzelereignisse möglich sind (Beispiel: eine Zahlung stellt einerseits eine Kommunikation im Wirtschaftssystem dar und zugleich eine Rechtssystem-Operation, weil durch sie eine Verbindlichkeit beglichen wird, woraufhin das Rechtsgefüge sich ändert),[36] wird unter strukturellen Koppelungen das Vertrauen eines Systems in den Bestand eines Umweltcharakteristikums (z.B. die Existenz von Geld) verstanden.[37] Mehrere Systeme beruhen auf gleicher Basis, die sie in ihrer jeweiligen Codierung eigenständig umsetzen. Trotzdem fungieren Umweltereignisse auch im Bereich struktureller Koppelungen nicht als „Input“ in ein System, sondern führen lediglich zur Irritation des Systems,[38] das diese als ein Problem im Umgang mit den eigenen Fragestellungen mittels seiner eigenen Strukturen wahrnimmt und somit in der Lage ist, nach einer – systeminternen – Reaktionsmöglichkeit zu suchen,[39] ohne die Komplexität der Umweltbedingen nachvollziehen zu müssen.[40]
27
Bei der näheren Betrachtung dieses Konzepts drängt sich der Gedanke der Differenzierung nach Rechtssetzungs- und Rechtsanwendungsphase auf: Während sich operative Koppelungen vor allem im Bereich der Rechtsanwendung (nicht zwangsläufig im Sinne einer gerichtlichen oder Verwaltungsentscheidung, sondern im Sinne einer – auch abstrakten – einzelfallbezogenen Subsumtion) abspielen – es geht um Einzelereignisse, die in mehreren Systemen Operationen auslösen –, spielen die strukturellen Koppelungen vor allem im Bereich der Rechtssetzung eine Rolle, wo auf gesellschaftliche (im Sinne der Systemtheorie: Umwelt-)Veränderungen durch eine Anpassung der Rechtslage reagiert werden kann (z.B. durch die Regelung des Umgangs mit einer neuentdeckten Technologie).
Читать дальше