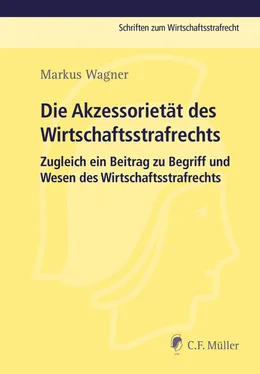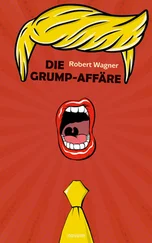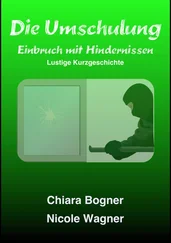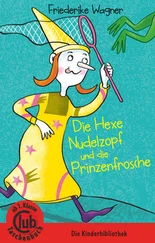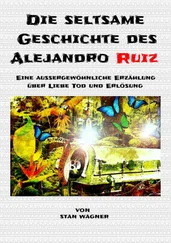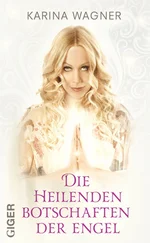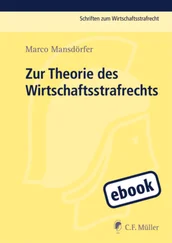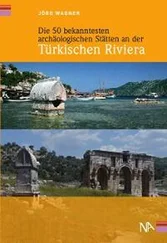2. Offene Generalverweisungen
a) „Rechtsvorschriften“
b) „Recht der Europäischen Gemeinschaften“
3. Einzelbegriffe
a) Legaldefinitionen
b) Richtlinienkonforme Auslegung
VII. Rückwirkungsverbot und lex mitior-Grundsatz
1. Überblick über die allgemeinen Grundstrukturen der zeitlichen Geltung im Strafrecht
2. Bedeutung im Akzessorietätskontext
a)Das Rückwirkungsverbot im engeren Sinne
aa) Sanktionsnorm
bb) Verhaltensnorm
(1) Formelle Gesetze und Rechtsverordnungen
(2) Rückwirkende Aufhebung behördlicher Genehmigungen
(3) Anfechtung privat- und öffentlich-rechtlicher Verträge
b) Der lex mitior-Grundsatz
aa) Die Stellung des lex mitior-Grundsatzes in der Rechtsordnung
bb) Die Anwendung des lex mitior-Grundsatzes bei Änderungen der außerstrafrechtlichen Bezugsnorm
(1) Beschränkung des lex mitior-Grundsatzes auf die Strafnorm (RGSt)
(2) Generelle Geltung des späteren Rechts (Tiedemann)
(3) Differenzierung nach Absicherung von Gehorsam oder Regelungseffekt (Jakobs u.a.)
(4) Differenzierung zwischen normativen Tatbestandsmerkmalen und Blankettmerkmalen I (Hassemer, Kargl)
(5) Differenzierung zwischen normativen Tatbestandsmerkmalen und Blankettmerkmalen II (Schuster)
(6) Vorhandensein einer Ermächtigungsnorm (Dannecker)
(7) Stellungnahme
cc) Anwendung des lex mitior-Grundsatzes bei Änderung von untergesetzlichen Normen
(1) Spätere Aufhebung eines belastenden (rechtswidrigen) Verwaltungsakts
(2) Nachträgliche behördliche Genehmigung
(3) Privatrechtliche Rechtsänderungen
dd) Zwischengesetze
ee) Zeitgesetze
ff) Sonstige Ausnahmeregelungen zum lex mitior-Grundsatz
gg) Besonderheiten im Zusammenhang mit Unionsrecht
VIII. Verbot strafschärfenden und strafbegründenden Gewohnheitsrechts
1. Konsequenzen für den zugrunde gelegten Begriff des Wirtschaftsstrafrechts – Zur Berücksichtigungsfähigkeit von Handelsbräuchen im Strafrecht
2. Der Unterscheid zwischen faktischer Übung und privater Normierung – ein Widerspruch zu Lasten des Betroffenen?
IX. Unschuldsvermutung
X. Einfachgesetzliche Akzessorietätsbegrenzungen
1. Akzessorietätsbegrenzung durch unterlassene Akzessorietätsbegründung im Gesetzestext? – § 330a StGB
2. Einfachgesetzliche Beschränkung des Akzessorietätsumfangs
3. Rechtsmissbrauchsklauseln
a) Grundsätzliche Problematik
b) Die einzelnen Rechtsmissbrauchsklauseln
c) Zulässigkeit der Rechtsmissbrauchsklauseln
d) Abschließende Sonderregelungen oder deklaratorische Ausprägung eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes?
e) Exkurs: Reichweite des § 330d Abs. 1 Nr. 5 StGB
XI. Strafrechtsdogmatische Akzessorietätsbegrenzungen
1. Schutzzweck der Norm
a) Rechtsgutsverschiebung beim Abrechnungsbetrug
b) Rechtsgüterschutz im Umweltstrafrecht
aa) Materielle Genehmigungsfähigkeit
bb) Nichtige Genehmigung
cc) Rechtswidriger, aber nicht nichtiger Verwaltungsakt
c) Kreis der tauglichen Anknüpfungspflichten bei § 258 StGB
2. Deliktstypus – Verletzungs- und Gefährdungsdelikte
a) Konkrete Gefährdungsdelikte
b) Abstrakte Gefährdungsdelikte
c) Zwischenergebnis
3. Unterlassungsdelikte – § 13 StGB
4. Verhältnismäßigkeitsprinzip/Ultima ratio-Grundsatz
B. Anwendungsbereich und Folgen einer Akzessorietätsbegrenzung
C. Zusammenfassung der Ergebnisse des dritten Teils
Teil 4 Prozessuale Aspekte der Akzessorietät
A. Präliminarien zum Verhältnis von materiellem Strafrecht und Strafprozessrecht
I. Akzessorietät des materiellen Strafrechts zum Strafprozessrecht?
II. Akzessorietät des Strafprozessrechts zum materiellen Strafrecht?
B. Die Befugnis des Strafrichters zur Klärung außerstrafrechtlicher Vorfragen
I. Grundsatz: Eigene Entscheidungsbefugnis des Strafrichters
II. Verwerfungskompetenz des Strafrichters bei Verwaltungsakten
III. Besonderheiten bei verfassungs- und unionsrechtswidrigen Gesetzen
IV. Revisibilität der Auslegung außerstrafrechtlichen Rechts
C. Die Feststellung außerrechtlicher Normen
I. Handhabung im Zivil- und Verwaltungsprozess
II. Übertragung dieser Grundsätze auf den Strafprozess
D. Die Wirtschaftsstrafkammern
I. Erster Reformvorschlag: Beiziehung von Fachschöffen
II. Zweiter Reformvorschlag: Anpassung des Zuständigkeitsbereichs der Wirtschaftsstrafkammer
III. Dritter Reformvorschlag: Verpflichtende Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften und entsprechende personelle Ausstattung der Polizei
IV. Exkurs: Keine Notwendigkeit der Einrichtung eines speziellen Wirtschaftsstrafsenats beim BGH
E. Zusammenfassung der Ergebnisse des vierten Teils
Teil 5 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
A. Das Wesen und die Akzessorietät des Wirtschaftsstrafrechts
B. Beispielhafte Anwendung der entwickelten Grundsätze
I.Der Einfluss von DIN-Normen auf das Strafrecht
1. Allgemeines zu DIN-Normen
2. Die Berücksichtigungsfähigkeit von DIN-Normen im Strafrecht
a) Dynamische Verweisungen auf DIN-Normen
b) Statische Verweisungen auf DIN-Normen
c) Einbeziehung über Technik-Klauseln
aa) Die allgemein anerkannten Regeln der Technik
bb) Der Stand der Technik
cc) Der Stand von Wissenschaft und Technik
3. Zusammenfassung
II.Der Einfluss der Deutschen Corporate Governance Kodex auf das Strafrecht
1. Allgemeines zum Deutschen Corporate Governance Kodex
2. Die Relevanz des Deutschen Corporate Governance Kodex im Rahmen des Untreuetatbestandes
a) Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex als taugliche Verhaltensnormen des § 266 StGB?
aa) Rechtliche Qualität des Deutschen Corporate Governance Kodex
bb) Verfassungsrechtliche Aspekte
(1) Verfassungsrecht als Prüfungsmaßstab
(2) Vereinbarkeit mit dem Demokratieprinzip
(3) Vereinbarkeit mit dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz – Publizitätserfordernis
(4) Zwischenergebnis
cc) Strafrechtsdogmatisches Erfordernis der Schutzzweckidentität
b) Begrenzungen durch die Sanktionsnorm
3. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Teil 1 Rechtstheoretische Grundlagen
Inhaltsverzeichnis
A. Der Begriff der Akzessorietät
B. Zielsetzung und Gang der Untersuchung
C. Die Basis der Untersuchung: Das Akzessorietätsphänomen
D. Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Teils
1
In einer Vielzahl der wirtschaftsstrafrechtlichen Veröffentlichungen findet sich der Begriff der „Akzessorietät“. In der Regel wird der Terminus dabei zu einem konkreten Delikt oder einer Deliktsgruppe in Bezug gesetzt; so ist etwa die Rede von der sog. „Verwaltungsakzessorietät des Umweltstrafrechts“[1], von der „Gesellschaftsrechtsakzessorietät“ des Untreuetatbestandes[2], von der „Sozialversicherungsrechtsakzessorietät des § 266a StGB“[3], der „Insolvenzrechtsakzessorietät“ der Bankrottdelikte,[4] der „Bilanzrechtsakzessorietät“ der §§ 331 ff. HGB[5] und der „Kartellrechtsakzessorietät“ des § 298 StGB[6]. Gemeint ist damit die Abhängigkeit des Verdikts der Strafbarkeit von Bestimmungen, die außerhalb des Strafrechts selbst liegen.
2
Dieser Befund erweckt den Eindruck, dass eine solchermaßen verstandene Akzessorietät lediglich ein Phänomen einzelner Straftatbestände sei. Ob das der Fall ist, wird im Zuge von Teil 1der Untersuchung zu erörtern sein.
Den Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung bildet daher die These, dass das Akzessorietätsphänomen einen allgemeinen Grundsatz darstellt.[7] Dabei soll außerdem nachgewiesen werden, dass dieser Grundsatz nicht auf das Wirtschaftsstrafrecht beschränkt ist, sondern generell dem Recht und insbesondere dem Strafrecht inne wohnt.
Читать дальше