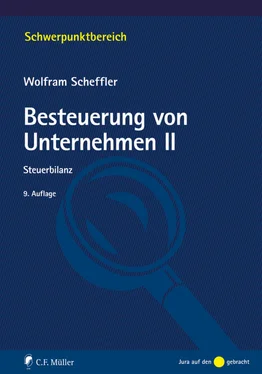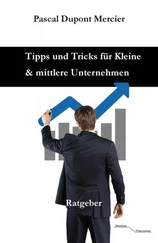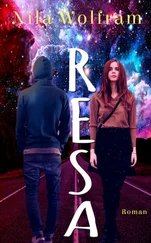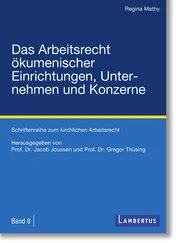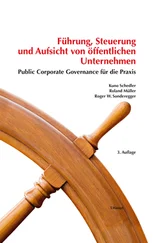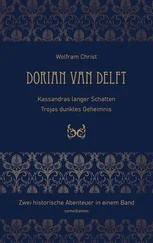Kein Wirtschaftsgutstellen beispielsweise die erwarteten Vorteile eines Werbefeldzugs oder von Public-Relations-Maßnahmen dar. Da ihr Wert nicht mit hinreichender Sicherheit zu quantifizieren ist, liegt das zur Objektivierung herangezogene Kriterium der selbständigen Bewertbarkeit nicht vor. Bei den Vorteilen aus einem hohen Ausbildungsstand der Mitarbeiter, der Organisationsstruktur des Unternehmens und den Standortbedingungen ist gleichfalls die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit abzulehnen. Diese wirtschaftlichen Vorteile gelten nicht als Wirtschaftsgut, vielmehr sind sie als unselbständige Teile des Geschäfts- oder Firmenwerts anzusehen.
152
Obwohl in weiten Bereichen die Prüfung, ob die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit gegeben ist, zu einem eindeutigen Ergebnis führt, verbleiben zahlreiche Fälle, in denen das Vorliegen eines Wirtschaftsgutskontrovers diskutiert wird. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die Interpretation des Kriteriums „selbständige Bewertbarkeit“ von subjektiven Einschätzungen abhängt. Im Kern lassen sich die Meinungsverschiedenheiten darauf zurückführen, welches Gewicht dem Gedanken einer objektivierten Vermögensermittlung beigemessen wird:
| – |
Je mehr gefordert wird, dass die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit intersubjektiv nachprüfbar sein muss, umso höhere Anforderungen werden an den Nachweis der selbständigen Bewertbarkeit gestellt und umso kleiner fällt der Kreis der wirtschaftlichen Vorteile aus, bei denen die Wirtschaftsguteigenschaft bejaht wird. |
| – |
Umgekehrt gilt: Je weniger gefordert wird, dass die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit intersubjektiv nachprüfbar sein muss, umso geringere Anforderungen werden an den Nachweis der selbständigen Bewertbarkeit gestellt und umso größer fällt der Kreis der wirtschaftlichen Vorteile aus, bei denen die Wirtschaftsguteigenschaft angenommen wird. |
Da für diesen Abwägungsprozess kein eindeutiger Beurteilungsmaßstabzur Verfügung steht, bleibt der Umfang der Aktiva unbestimmt. Dies ist insbesondere deshalb unbefriedigend, weil bei einer Gewinnermittlung durch einen Betriebsvermögensvergleich die Höhe der in den einzelnen Perioden ausgewiesenen Einkünfte aus Gewerbebetrieb in starkem Maße davon abhängt, welche Vermögenswerte in die Berechnung des Reinvermögens einbezogen werden (Wirtschaftsguteigenschaft wird bejaht) und welche Ausgaben sofort als Betriebsausgabe verrechnet werden (Vorliegen eines Wirtschaftsguts wird verneint).
[1]
Zum Begriff des passiven Wirtschaftsguts siehe Dritter Abschnitt, Kapitel A.I., Rn. 455–473. Wird im Folgenden der Begriff „Wirtschaftsgut“ ohne Zusatz verwendet, sind aktive Wirtschaftsgüter gemeint.
[2]
Vgl zB RFH vom 27.3.1928, RStBl. 1928, S. 260; BFH vom 29.4.1965, BStBl. 1965 III, S. 414; BFH vom 6.12.1990, BStBl. 1991 II, S. 346; BFH vom 19.6.1997, BStBl. 1997 II, S. 808. In der Literatur finden sich zahlreiche unterschiedliche Erläuterungen des Begriffs „Wirtschaftsgut“. Die folgenden Erläuterungen lehnen sich an Blümich, EStG, KStG, GewStG, München (Loseblattausgabe), § 5 EStG, Rz. 303–314; Herrmann/Heuer/Raupach, Einkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetz, Köln (Loseblattausgabe), § 5 EStG, Anm 550–555; Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, Heidelberg (Loseblattausgabe), § 5 EStG, Rdnr. B 169–175, an.
2. Abgrenzung zwischen Wirtschaftsgut und Vermögensgegenstand
153
Die steuerrechtliche Gewinnermittlung ist zwar über das Maßgeblichkeitsprinzip mit der handelsrechtlichen Rechnungslegung verbunden. Dennoch bestimmt sich die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit auf der Aktivseite für die Steuerbilanz anhand des Begriffs „Wirtschaftsgut“ und nicht anhand des im Handelsgesetzbuch verwendeten Begriffs „Vermögensgegenstand“. Im Folgenden wird im ersten Schritt die Definition des handelsrechtlichen Begriffs des Vermögensgegenstandsvorgestellt. Im zweiten Schritt werden die zwischen den beiden Begriffen bestehenden Gemeinsamkeiten und Unterschiedeherausgearbeitet.
a) Begriff des Vermögensgegenstands
154
Das Handelsgesetzbuchenthält keine allgemeine Definitiondes Begriffs des Vermögensgegenstands, sondern lediglich eine Untergliederung in Grundstücke, Forderungen, bares Geld und sonstige Vermögensgegenstände (§ 240 Abs. 1 HGB) sowie in Anlagevermögen und Umlaufvermögen (§ 247 Abs. 1, 2 HGB). Die Kriterien, anhand derer die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit zu beurteilen ist, müssen deshalb aus dem Zweck des handelsrechtlichen Einzelabschlusses abgeleitet werden. Nach traditionellem Verständnis wird in diesem Zusammenhang in erster Linie auf den Gläubigerschutz abgestellt. Die Handelsbilanz soll Aussagen darüber erlauben, ob das Vermögen ausreicht, um die Schulden des Unternehmens zu decken. Bei der Definitiondes Begriffs „Vermögensgegenstand“ wird deshalb darauf abgestellt, ob ein wirtschaftlicher Vorteil geeignet ist, einen Beitrag zur Deckung der Zahlungsverpflichtungen des Unternehmenszu leisten.
Über die Kriterien, anhand derer sich für die Handelsbilanz die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit bestimmt, besteht zwar keine einheitliche Auffassung. Überwiegend wird jedoch davon ausgegangen, dass ein Vermögensgegenstand dann vorliegt, wenn ein wirtschaftlicher Vorteil selbständig verwertbarist.[1] Entscheidend ist, ob es möglich ist, durch den wirtschaftlichen Vorteil einen Zufluss an finanziellen Mitteln zu generieren.
Die selbständige Verwertbarkeitunterteilt sich in:
| – |
Verwertung durch Veräußerung, |
| – |
Verwertung durch Nutzungsüberlassung, |
| – |
Verwertung durch bedingten Verzicht und |
| – |
Verwertung durch Zwangsvollstreckung. |
Eine Verwertung durch Veräußerungliegt vor, wenn die Sache, das Recht oder der sonstige wirtschaftliche Vorteil als solcher an einen Außenstehenden veräußert werden kann, dh im Rechtsverkehr allein übertragen werden kann. Die selbständige Verwertbarkeit ist auch erfüllt, wenn der wirtschaftliche Vorteil dadurch zu Geld gemacht werden kann, dass er an Außenstehende zur Nutzung überlassen wird (Verwertung durch Nutzungsüberlassung). Ein Beitrag zur Deckung der Zahlungsverpflichtungen des Unternehmens kann des Weiteren dadurch geleistet werden, dass der Inhaber eines Rechts unter der Bedingung auf dieses Recht verzichtet, dass das Recht einer anderen Person eingeräumt wird. Die Verwertung durch bedingten Verzichtist insbesondere für Konzessionen bedeutsam. Wirtschaftliche Vorteile, die zwar ihrer Natur nach einzeln veräußerbar sind oder zur Nutzung überlassen werden können, aber aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Beschränkungen nicht übertragen oder überlassen werden dürfen, können möglicherweise im Rahmen einer Zwangsvollstreckung verwertet werden (Verwertung durch Zwangsvollstreckung).
[1]
Vgl Adler/Düring/Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, 6. Aufl., Stuttgart 1998, § 246 HGB, Tz. 9–33; Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen, 14. Aufl., Düsseldorf 2017, S. 158–166; Ballwieser, Grundsätze der Aktivierung und Passivierung, in: Böcking/Castan/Heymann ua (Hrsg.), Beckʼsches Handbuch der Rechnungslegung, München (Loseblattausgabe), B 131, Rz. 10–15.
b) Vergleich von Wirtschaftsgut und Vermögensgegenstand
155
(1) Grundsätzliche Analyse: Ausgangspunkt des Vergleichs zwischen den beiden Begriffen (aktives) Wirtschaftsgut und Vermögensgegenstand bildet § 5 Abs. 1 S. 1 HS 1 EStG, wonach in der Steuerbilanz das Betriebsvermögen anzusetzen ist, das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist. Der Ansatz dem Grunde nach richtet sich ausschließlich nach § 5 EStG, denn aus dem Einleitungssatz des § 6 Abs. 1 EStG geht ausdrücklich hervor, dass sich diese Vorschrift nur auf die Bewertung des Betriebsvermögens bezieht.
Читать дальше