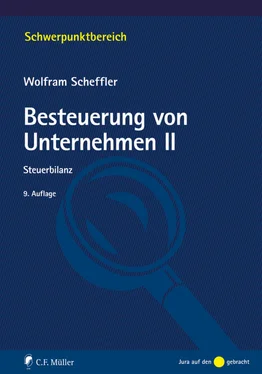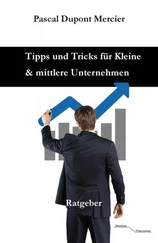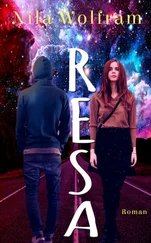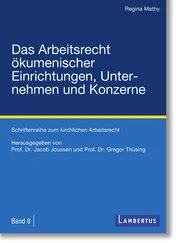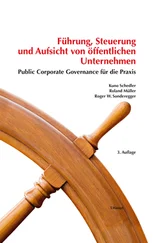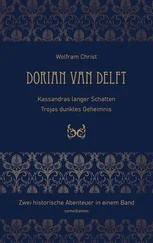2. Realisationsprinzip (Ertragsantizipationsverbot, Anschaffungswertprinzip)
3. Abgrenzung von Aufwendungen der Sache nach
4. Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen der Zeit nach
VI.Konventionen zur Beschränkung von gewinnabhängigen Zahlungen
1. Zielsetzung und Verhältnis zum Vorsichtsprinzip
2. Imparitätsprinzip (Aufwandsantizipationsgebot)
3. Grundsatz der Bewertungsvorsicht (Vorsichtsprinzip im engeren Sinne)
Zweiter Abschnitt Bilanzierung und Bewertung der aktiven Wirtschaftsgüter in der Steuerbilanz
A. Bilanzierung von Wirtschaftsgütern
I. Bilanzierungskonzeption
II.Abstrakte Bilanzierungsfähigkeit
1. Begriff des aktiven Wirtschaftsguts
2. Abgrenzung zwischen Wirtschaftsgut und Vermögensgegenstand
a) Begriff des Vermögensgegenstands
b) Vergleich von Wirtschaftsgut und Vermögensgegenstand
3. Abgrenzung zwischen selbständigen Wirtschaftsgütern
4. Einteilung der Wirtschaftsgüter entsprechend ihrer steuerlichen Relevanz
a) Abgrenzung zwischen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens und Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens
b) Abgrenzung zwischen materiellen, nominalgüterlichen und immateriellen Wirtschaftsgütern
c) Abgrenzung zwischen abnutzbaren und nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern
d) Abgrenzung zwischen beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern
III. Konkrete Bilanzierungsfähigkeit
1.Gesetzliche Regelungen zum Ansatz
a) Grundsatz: Aktivierungspflicht
b) Besonderheiten bei immateriellen Wirtschaftsgütern
c) Zusätzliche Besonderheiten beim Geschäfts- oder Firmenwert
2.Persönliche Zurechnung (wirtschaftliches Eigentum)
a) Der Begriff des wirtschaftlichen Eigentums
b) Abgrenzung des wirtschaftlichen Eigentums vom handelsrechtlichen Begriff der wirtschaftlichen Zurechnung
c) Abweichungen zwischen zivilrechtlichem und wirtschaftlichem Eigentum
3.Sachliche Zurechnung (Abgrenzung des Umfangs des Betriebsvermögens)
a) Grundsätzliche Regelungen
b) Spezielle Regelungen
B.Bewertung von Wirtschaftsgütern
I.Bewertungskonzeption (PIL-Konzept)
1. Überblick über die relevanten Bewertungsmaßstäbe
2. Überblick über die Bewertung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
3. Überblick über die Bewertung von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens
II. Basiswerte (Bewertung bei Zugang auf der Grundlage der Periodisierungsgrundsätze)
1. Anschaffungskosten
a) Definition
b) Bestandteile
c) Besonderheiten bei Ermittlung der Anschaffungskosten
2.Herstellungskosten
a) Definition
b) Bestandteile
c) Besonderheiten bei Ermittlung der Herstellungskosten
3. Spezialfragen bei Gebäuden
4. Investitionszulagen und -zuschüsse
5.Bewertungsvereinfachungen
a) Einordnung in das System der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
b) Festbewertung
c) Gruppenbewertung
d) Sammelbewertung (Verbrauchsfolge- oder Veräußerungsfolgeverfahren)
III.Modifizierte Basiswerte (fortgeführte Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf der Grundlage der Periodisierungsgrundsätze)
1.Begriff und Aufgaben von planmäßigen Abschreibungen (Abgrenzung von Aufwendungen der Sache und der Zeit nach)
a) Die um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Wertobergrenze
b) Begründung für die planmäßigen Abschreibungen
c) Abgrenzung der planmäßigen Abschreibungen gegenüber den außerplanmäßigen Abschreibungen
2. Absetzung für Abnutzung und Absetzung für Substanzverringerung
a) Abschreibungssumme
b) Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts
c) Abschreibungsmethode
d) Wechsel der Abschreibungsmethode
e) Beginn und Ende der Abschreibungen
f) Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
g) Änderungen des Abschreibungsplans
h) Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung
IV. Vergleichswert (Teilwertabschreibung auf der Grundlage des Imparitätsprinzips)
1. Begriff und Aufgaben von außerplanmäßigen Abschreibungen (Imparitätsprinzip)
2. Gesetzliche Grundlagen des Niederstwertprinzips
a) Voraussichtlich dauernde Wertminderungen
b) Voraussichtlich vorübergehende Wertminderungen
c) Abgrenzung zwischen voraussichtlich dauernden und voraussichtlich vorübergehenden Wertminderungen
d) Einschränkungen bei der aufwandswirksamen Verrechnung von Teilwertabschreibungen bei Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
e) Besonderheit: Bildung von Bewertungseinheiten
3. Abschreibung auf den niedrigeren Teilwert
a) Teilwertdefinition
b) Teilwertvermutungen
c) Widerlegung der Teilwertvermutungen
d) Besonderheiten bei Ermittlung des Teilwerts
e) Ergebnis
4. Vergleich mit den in der Handelsbilanz herangezogenen Vergleichswerten
5.Vergleich mit den auf den Periodisierungsgrundsätzen basierenden Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung
a) Anwendungsbereich und Voraussetzungen der Absetzungen für außergewöhnliche Abnutzung
b) Abgrenzung gegenüber der Abschreibung auf den niedrigeren Teilwert
6.Wertaufholungen (Zuschreibungen)
a) Wertaufholungsgebot in der Steuerbilanz
b) Beurteilung der Zuschreibungspflicht
V.Steuerliche Sondervorschriften (überhöhte Abschreibungen auf den niedrigeren steuerlichen Wert auf der Grundlage des Lenkungszwecks der Steuerbilanz)
1. Zielsetzung steuerlicher Sondervorschriften
2. Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzungen
3. Bewertungsabschläge
VI.Sonderregelungen
1. Bewertung von Finanzinstrumenten bei Kreditinstituten mit dem beizulegenden Zeitwert
2. Währungsumrechnung
Dritter Abschnitt Bilanzierung und Bewertung der passiven Wirtschaftsgüter in der Steuerbilanz
A. Ansatz dem Grunde nach
I.Abstrakte Bilanzierungsfähigkeit
1. Begriffsabgrenzung
2. Verpflichtung
3. Verursachung vor dem Abschlussstichtag
4. Hinreichende Konkretisierung
II.Konkrete Bilanzierungsfähigkeit
1.Gesetzliche Regelungen zum Ansatz
a) Überblick
b) Verbindlichkeiten
c) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
d) Rückstellungen für Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden (Kulanzrückstellungen)
e) Verpflichtungen im Zusammenhang mit schwebenden Geschäften
f) Aufwandsrückstellungen
2. Zurechnung
B.Bewertung von bilanziellen Schulden
I. Bewertungsgrundsätze
II. Bewertung von Verbindlichkeiten (sichere Verpflichtungen)
III. Bewertung von Rückstellungen (ungewisse Verpflichtungen)
1. Berücksichtigung der Ungewissheit
2. Konkretisierung der einzubeziehenden Berechnungsgrößen
a) Mehrjährige Verpflichtungen
b) Umfang der einzubeziehenden Aufwendungen bei Sachleistungsverpflichtungen
c) Maßgeblichkeit der am Abschlussstichtag geltenden Wertverhältnisse
d) Abzinsungsgebot
e) Saldierung von positiven und negativen Erfolgsbeiträgen
f) Bewertungsvereinfachungen
g) Handelsrechtlicher Wert als Obergrenze
C. Übertragung von Verpflichtungen mit Ansatz- oder Bewertungsvorbehalten („angeschaffte Rückstellungen“)
Vierter Abschnitt Bilanzierung und Bewertung der weiteren Bilanzposten in der Steuerbilanz
A. Abgrenzungsposten
I. Aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten
II. Disagio als spezieller aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
III. Steuerlich motivierte Sonderformen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
IV. Begründung für den Nichtansatz von latenten Steuern
B.Steuerfreie Rücklagen
I. Abstrakte Bilanzierungsfähigkeit (Zielsetzung steuerfreier Rücklagen)
Читать дальше