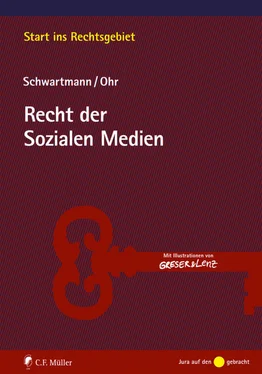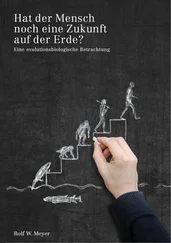5. Verstöße gegen Verhaltensregeln
42
Neben den Nutzungsbedingungen halten die Social Media-Anbieter häufig auch Verhaltensregeln oder Communitystandards bereit, die insbesondere den zwischenmenschlichen Umgang der Nutzer untereinander betreffen. Ebenso wie bei den Nutzungsbedingungen handelt es sich dabei um Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 Abs. 1 BGB, die der ordnungsgemäßen vertraglichen Einbeziehung bedürfen (§ 305 Abs. 2 BGB) und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit der Inhaltskontrolle unterliegen (§§ 307 ff. BGB). Obwohl die Verhaltensregeln gerade die Beziehungen der Nutzer untereinander betreffen, entfalten sie unmittelbare Geltung ausschließlich vertikal im Verhältnis zwischen Nutzer und Anbieter. Eine horizontale Wirkung im Hinblick auf die Nutzer untereinander besteht dagegen nicht. Zwar können die zwischen Plattformbetreiber und Nutzer vereinbarten Bedingungen im Verhältnis zwischen den Nutzern fortwirken, indem sie dort als Auslegungshilfe herangezogen werden.[34] Dies gilt jedoch nur dann, wenn zwischen den Nutzern ein Vertragsverhältnis begründet worden ist, welches einer Auslegung nach §§ 133, 157 BGB dem Grunde nach zugänglich ist. Im Rahmen sozialer Medien gehen die Nutzer untereinander indessen regelmäßig keine vertraglichen Beziehungen ein. An der Tagesordnung sind vielmehr gesetzliche Schuldverhältnisse in Form von Schadenersatz- oder Unterlassungsansprüchen, etwa dann, wenn ein Nutzer über einen anderen persönlichkeitsverletzende Inhalte verbreitet.[35]
43
Verstoßen die Nutzer im gegenseitigen Umgang gegen die Verhaltensregeln, muss demnach der Social Media-Anbieter tätig werden, um die Einhaltung der von ihm aufgestellten gemeinschaftlichen Standards durchzusetzen bzw. wiederherzustellen. Insoweit kommt die Entfernung des regelwidrigen Inhalts, die kurz- oder längerfristige Sperrung des Nutzeraccounts, von welchem der Verstoß ausgeht, oder bei schwerwiegenden Verstößen die vollständige Löschung des Profils in Betracht.[36]
6. Beendigung der Social Media-Nutzung
44
Während sich die Social Media-Anbieter im Rahmen ihrer Nutzungsbedingungen bzw. Verhaltensregeln Möglichkeiten einer vertraglichen Loslösung vorbehalten, besteht für die Nutzer regelmäßig kein großes praktisches Bedürfnis, den Social Media-Vertrag im Wege einer offiziellen Kündigung zu beenden. Weil die Dienste sozialer Medien regelmäßig unentgeltlich angeboten werden, kann die Nutzung schlichtweg eingestellt werden, ohne dass eine förmliche Abmeldung erfolgen muss. Dementsprechend finden sich in Social Media-Verträgen meist auch keine besonderen Kündigungsregelungen.[37]
45
Handelt es sich ausnahmsweise um einen entgeltlichen Vertrag oder nimmt der jeweilige Nutzer kostenpflichtige Premium-Dienste eines sozialen Mediums in Anspruch, liegt es dagegen im Interesse beider Parteien, die Kündigungsmodalitäten explizit zu regeln. Die rechtliche Zulässigkeit derartiger Regelungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen richtet sich hier nach § 309 Nr. 9 BGB. Danach darf der Nutzer nicht länger als zwei Jahre an den Vertrag gebunden werden (§ 309 Nr. 9a BGB). Unzulässig ist ebenfalls die stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhältnisses um mehr als ein Jahr (§ 309 Nr. 9b BGB) sowie die Festlegung einer längeren Kündigungsfrist als drei Monate vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stillschweigend verlängerten Vertragsdauer (§ 309 Nr. 9c BGB).[38]
6.2 Tod des Accountinhabers
46
Mit dem Tod des Inhabers eines Social Media-Accounts erlischt nicht zugleich dessen virtuelle Präsenz im Internet. Vielmehr bleiben die Daten und Inhalte, die der Nutzer zu Lebzeiten generiert hat, auf dem Server des jeweiligen Anbieters bestehen. Zur Abwicklung bestehender Vertragsverhältnisse des Verstorbenen sind Angehörige immer häufiger auch auf den Zugang zu online hinterlegten Informationen und Dokumenten angewiesen. Gemäß § 1922 Abs. 1 BGB geht mit dem Tode einer Person deren Vermögen als Ganzes auf die Erben über. Körperliche Datenträger, auf denen sich die benötigten Informationen befinden, werden von dieser Universalsukzession erfasst und sind daher von vornherein dem unbeschränkten Zugriff der Erben eröffnet. Dies gilt nicht nur für das jeweilige Speichermedium selbst, sondern auch für die darauf befindlichen Daten.[39] Schwieriger stellt sich dies im Hinblick auf diejenigen Daten dar, die auf dem Server eines Social Media-Anbieters gespeichert sind. Weil der Tod des Nutzers an den Eigentumsverhältnissen hinsichtlich des Servers nichts ändert, ist fraglich, ob die Erben dennoch Zugriff auf die Daten des Verstorbenen beanspruchen können. Mangels entgegenstehender Interessen geht nach § 1922 Abs. 1 BGB auch der Social Media-Vertrag als Schuldverhältnis auf die Erben über. Aus erbrechtlicher Perspektive ergibt sich ein Zugriffsrecht auf die Accountdaten daher aus dem Eintritt in die Vertragsposition des verstorbenen Nutzers. Hieraus können die Erben zugleich einen Auskunftsanspruch im Hinblick auf die jeweiligen Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) herleiten.[40]

[Bild vergrößern]

[Bild vergrößern]
47
Sofern aber im Wege des Erbrechts ein uneingeschränkter Zugang zu sämtlichen Accounts des Verstorbenen eröffnet wird, trägt dies weder dem verfassungsrechtlich verankerten postmortalen Persönlichkeitsschutz noch den einfachrechtlichen Belangen des Datenschutzes hinreichend Rechnung. Das Auskunfts- und Nutzungsverlangen der Erben im Hinblick auf die Daten des Erblassers muss dort seine Grenze finden, wo bereits das Wissen um das künftige Bestehen derartiger Ansprüche die freie Entfaltung der Persönlichkeit des Erblassers zu Lebzeiten hindert.[41] Der Nutzer eines E-Mail- oder Social Media-Accounts wird sich in den betreffenden Kommunikationsräumen unter Umständen anders verhalten, wenn er weiss, dass seine Erben nach seinem Ableben auf sämtliche dort vorgehaltenen Inhalte und Informationen zugreifen können. Vor diesem Hintergrund muss dem Verstorbenen ein Recht auf Respektierung seines zu Lebzeiten kreierten Persönlichkeitsbildes zugestanden werden. Solange der Erblasser nicht den ausdrücklichen oder stillschweigenden Willen zur Freigabe seiner Daten zum Ausdruck gebracht hat, ist der Diensteanbieter daher nicht zur Herausgabe der jeweiligen Zugangsdaten an die Erben berechtigt. Als problematisch kann sich das grundsätzliche Verbot der Datenweitergabe indessen im Hinblick auf vermögensrechtliche Positionen des digitalen Nachlasses darstellen. Sind im Rahmen des Accounts etwa geschäftliche Daten hinterlegt, sind die Erben auf den Erhalt dieser Informationen regelmäßig angewiesen und können diesen aufgrund des ganzheitlichen Vermögensübergangs nach § 1922 Abs. 1 BGB auch beanspruchen. Praktische Schwierigkeiten ergeben sich jedoch aus der Trennung privater, dem postmortalen Persönlichkeitsschutz unterliegenden, und die Vermögenssphäre betreffenden, den Erben zugänglichen Daten. Handelt es sich um einen gemischt-genutzten Account, bedarf es einer sorgfältigen Trennung beider Bereiche. Insoweit wird es Aufgabe der Diensteanbieter sein, die technischen Voraussetzungen für eine solche datenmäßige Differenzierung zu schaffen.[42] Zugleich müssen Funktionen geschaffen werden, die dem Nutzer bereits bei erstmaliger Registrierung eine Entscheidung abverlangen, wie mit seinen Daten im Todesfall verfahren werden soll.[43]
Читать дальше