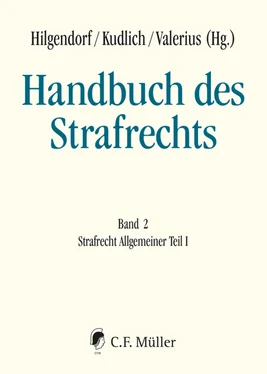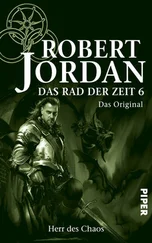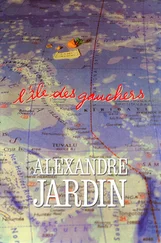2
Ist dieser Schritt vollzogen, also ein bestimmtes Konzept zugrunde gelegt, lässt sich das Unrecht durchaus als Inbegriff aller Voraussetzungen definieren, „die das Urteil begründen, der Täter habe sich in strafrechtlich erheblicher Weise rechtswidrig verhalten“.[11] Der Unrechtsbegriff fungiert dann als Verbindungsglied zwischen jenen abstrakten Legitimationsmodellen und der Strafrechtsdogmatik überhaupt, gilt doch bereits der Tatbestand – sprich: die erste Stufe der Deliktsverwirklichung – als „vertyptes Unrecht“. Der Unrechtsbegriff wird damit samt seiner Komponenten zum Anknüpfungspunkt der verschiedenen Erscheinungsformen der Straftat und zum „Skelett“ einer jeden Deliktsverwirklichung, welcher dank seiner zwei „variablen Bausteine“[12] die Strukturierung des Unrechtkerns eines Deliktstatbestands erleichtert und damit als Argumentationsgrundlage strafrechtsdogmatischer Streitfragen dienen kann.[13] Nicht selten geht damit in Abweichung vom herrschenden dreistufigen Deliktsaufbau – zumindest in der Argumentation – eine „Rückkehr“ zur Dichotomie von „Unrecht und Schuld“ einher;[14] dies kommt deutlich zum Vorschein, soweit Erlaubnissätze als „umgekehrte Unrechtsmerkmale“ kompensierende Wirkung entfalten sollen.[15] So können Fragen „an den Rändern“ der allgemeinen Verbrechenslehre auf die abstraktere Ebene des Unrechts transferiert und dort gelöst werden (so etwa beim Erlaubnistatbestandsirrtum, beim Fehlen eines subjektiven Rechtfertigungselements, vgl. Rn. 17, aber auch bei der hypothetischen Einwilligung). Gewisse Unrechtskomponenten (insb. das Erfolgsunrecht, soweit man dieses mit der überzeugenden h.M. als „unrechtskonstitutiv“ erachtet[16]) dienen als Auslegungsstütze für „analoge“ Tatbestände (so beim Computerbetrug gem. § 263a StGB), können aber auch zur Begründung von Auslegungsspielarten (etwa bei den Brandstiftungsdelikten) herangezogen werden. Während der Begriff des „Unrechts“ in der Lehre ganz unterschiedliche Ausprägungen erfährt und damit auch in abweichendem Kontext aufgegriffen wird, spielt er in der Rechtsprechung überwiegend im Bereich der Strafzumessung eine Rolle (vgl. Rn. 45 ff.).
II. Terminologie: Unrecht und …
1. Unrecht und Tatbestand
3
Die dargestellten Unklarheiten hinsichtlich des eigentlichen Gegenstands und der Funktion des Unrechtsbegriffs schlagen sich auch in terminologischen Unsicherheiten nieder. Dies gilt vornehmlich für die Hauptkomponenten des Unrechtsbegriffs, das Handlungs- und Erfolgsunrecht. Als vom dreistufigen Deliktsaufbau losgelöste „Basiselemente“[17] können Erfolgs- und Handlungsunrecht keine Synonyme für den objektiven und subjektiven Tatbestand darstellen. Deutlich wird das Auseinanderdriften von Tatbestandslehre und Unrechtsbegriff, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Handlungsunrecht – zumindest nach wohl h.A. – sowohl subjektive als auch objektive Komponenten beinhaltet,[18] insb. was die Art und Weise der Herbeiführung des Erfolgsunrechts angeht.[19] Der Umstand, dass die Unrechtselemente an etwaige Rechtfertigungsgründe gekoppelt sind, demonstriert ebenso, dass ein Gleichlauf nicht zwingend ist.[20] Dabei ist die Trennung der beiden „Unrechtsbausteine“ – in Anbetracht ihrer Beziehung zueinander – als Arbeitshypothese zu verstehen. Hält man sich dies vor Augen, scheint eine begriffliche Aufspaltung zweckmäßig.[21]
4
Hingegen dürften die Begriffe des Handlungs- und Erfolgs unwerts keine autonome Kategorie außerhalb von Recht und Unrecht darstellen, sondern synonym zum Begriffspaar „Handlungs- und Erfolgsunrecht“ gebraucht werden[22] und somit keine eigenständige Bedeutung haben. Der „Unwert“ als kategorialer Begriff passt allenfalls sprachlich in Bezug auf Gesinnungsmerkmale besser, da es in einem Tatstrafrecht, in dem die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Unrecht und Schuld anerkannt ist (vgl. bereits Rn. 2), kein „Gesinnungs unrecht “ geben kann. Eine andere Frage ist hingegen, inwiefern etwaige Gesinnungsmerkmale zugleich das Auslegungspotential mitbringen, um als das Unrecht erhöhende Merkmale zu fungieren (etwa eine grausame Tötung[23]).
3. Unrecht und Rechtswidrigkeit
5
In Abgrenzung zur Rechtswidrigkeit hat der Begriff des Unrechts mehr „Tiefgang“,[24] d.h. er beschreibt erst Ausmaß und Qualität des rechtswidrigen Verhaltens (und ist insoweit auch quantifizierbar[25]). Auch wenn im Zusammenhang mit dem dreistufigen Deliktsaufbau meist gelehrt wird, dass auf der Ebene der „Rechtswidrigkeit“ das endgültige Unwerturteil über das im Raum stehende Verhalten gefällt werde, ändert dies nichts daran, dass damit letztlich nur der Widerspruch zwischen Norm und Handlung – also das „Missverhältnis zwischen zwei Beziehungsgliedern“ – gemeint ist. Während also ein Verhalten kategorisch[26] entweder rechtswidrig ist oder eben nicht,[27] kann der Unrechtsgehalt einer Tat quantitativ wie auch qualitativ näher konkretisiert werden.
6. Abschnitt: Die Straftat› § 29 Handlungs- und Erfolgsunrecht sowie Gesinnungsunwert der Tat› B. Die (notwendigen) Komponenten des Unrechts
B. Die (notwendigen) Komponenten des Unrechts
6
Der heutige Unrechtsbegriff und sein Gehalt (insb. seine Komponenten und deren Beziehungsverhältnis zueinander) sind mittlerweile weitgehend anerkannt; mag man über seine Bedeutung für verschiedene Verbrechenslehren im Detail diskutieren – die daraus gezogenen praktischen Konsequenzen (etwa im Bereich des umgekehrten Erlaubnistatbestandsirrtums) sind überwiegend anerkannt, können aber jedenfalls allgemein nachvollzogen werden.
I. Entwicklung der Unrechtslehre[28]
7
Der Weg zu den Grundpfeilern des Erfolgs- und Handlungsunrechts war derjenige der Verbrechens- bzw. Handlungslehre[29] überhaupt, deren Fortentwicklung auch zu einer Evolution des Unrechtsbegriffs führte, die in → AT Bd. 2: Eric Hilgendorf , System- und Begriffsbildung im Strafrecht, § 27 insb. Rn. 40 ff.näher beschrieben wird und hier daher nur schlagwortartig nachvollzogen werden muss:[30] Nachdem noch im frühen 20. Jahrhundert die kausale Handlungslehre die Handlung als „rein äußeren Vorgang“ von den subjektiven Vorstellungen bzw. dem Willen des Täters als „reinem Internum“ trennte und Unrecht in diesem „Beling/von Liszt’schen“ System[31] demnach eine objektive Rechtsgutsverletzung bzw. eine Rechtsübertretung durch ursächliches Verhalten war,[32] wurde das Vorstellungsbild des Täters (nach vorsichtiger Anerkennung subjektiver Unrechtselemente[33] in der „Übergangsphase“ des neoklassischen Verbrechenssystems[34]) mit Welzels finaler Handlungslehre als „finale Überdetermination in Gestalt der Antizipation des Kausalverlaufs“[35] (oder als „Ausübung von Zwecktätigkeit“[36]) der bloßen Außenweltveränderung gegenübergestellt. Die besondere Schuldform des „Vorsatzes“ ging in jener Finalität auf und wurde nunmehr als Unrechtselement klassifiziert. Der Intentionsunwert[37] als subjektiver Teil des Handlungsunrechts sollte durch den Verhaltensunwert (als objektiver Teil des Handlungsunrechts) ergänzt werden. Obwohl sich der Finalismus als solcher nur zu einem Teil durchgesetzt hat,[38] blieben seine konkreten Ausprägungen im heutigen neoklassisch-finalen Verbrechensaufbau wie auch im Unrechtsbegriff als „Stichworte“ zu großen Teilen erhalten.
8
Die Forderung nach einer Handlungsunrechtskomponente ist im Grundsatz auch überzeugend und berechtigt. Das zeigt sich schon bei der Vielzahl der Delikte, bei denen ausdrücklich nicht jede Herbeiführung des tatbestandlichen Erfolges unter Strafe gestellt ist, sondern nur Erfolgsverursachungen durch bestimmte, näher beschriebene Verhaltensweisen, die ihrerseits für die Missbilligung des Verhaltens bedeutsam sind. Bei anderen Tatbeständen begründen bestimmte Begehungsweisen (z.B. mit besonders gefährlichen Werkzeugen oder in bandenmäßiger Weise) zumindest einen Qualifikationstatbestand. Allgemeiner gesprochen: Der Gesetzgeber berücksichtigt bei der Konturierung des durch die Tatbestandsfassung vertypten Unrechts nicht nur die Verletzung des geschützten Rechtsguts als eingetretenen Erfolg, sondern auch den Angriffsweg[39] als spezielle Qualität der Verletzungshandlung. Dieser Umstand fügt sich in eine Entwicklung ein, die Schünemann für das Strafrecht auf seinem Weg von der archaischen zur modernen Gesellschaft anschaulich und überzeugend nachgezeichnet hat: Dieser ist dadurch geprägt, dass weg vom bloßen Abstellen auf ein rein äußeres Geschehen oder jedenfalls auf die Kasuierung eines Erfolges die subjektive Verantwortung immer stärker mitberücksichtigt wird.[40] Das bis heute herrschende Verständnis geht diesen Weg freilich nicht im Sinne eines monistisch-subjektiven Ansatzes Armin Kaufmann ’scher Prägung[41] konsequent bis zu der Vorstellung zu Ende, dass etwa Verletzungs- bzw. Außenwelterfolge nur als objektive Bedingungen der Strafbarkeit verstanden würden; vielmehr werden i.S. einer „dualistischen Unrechtslehre“[42] schädliche Erfolge weiterhin als negative Faktoren bei der Bestimmung der Unrechtsqualität einbezogen.[43]
Читать дальше