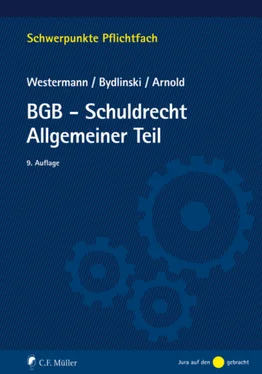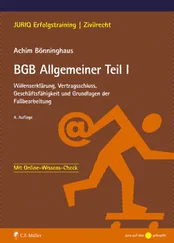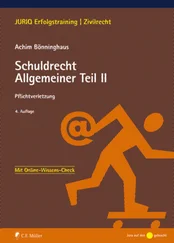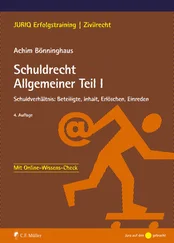a) Normzweck
b) Teilweises Entfallen bei Teilunmöglichkeit (§ 326 Abs. 1 S. 1 2. HS)
c) Ausschluss der Grundregel gem. § 326 Abs. 1 S. 2
3.Ausnahmen vom Grundsatz des § 326 Abs. 1 S. 1
a) Vom Gläubiger zu verantwortende Unmöglichkeit (§ 326 Abs. 2 S. 1 1. Alt.)
b) Annahmeverzug des Gläubigers (§ 326 Abs. 2 S. 1 2. Alt.)
c) Anrechnung von Ersparnissen (§ 326 Abs. 2 S. 2)
4. Beiderseits zu vertretende Unmöglichkeit
5. Inanspruchnahme des Surrogats gem. § 285 (§ 326 Abs. 3)
6. Rückforderung nicht geschuldeter Gegenleistungen (§ 326 Abs. 4)
7.Rücktrittsrecht (§ 326 Abs. 5)
a) Regelungszweck
b) Teilunmöglichkeit (§ 326 Abs. 5 2. HS iVm § 323 Abs. 5 S. 1 und S. 2)
8. Lösung Fall 47
IV. Sekundärleistungsansprüche als Folge der Unmöglichkeit
1. Schadensersatz statt der Leistung
a) Schadensersatz statt der Leistung bei anfänglicher Unmöglichkeit (§ 311a Abs. 2)
b) Schadensersatz statt der Leistung bei nachträglicher Unmöglichkeit (§§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283)
c) Besonderheiten bei Teilunmöglichkeit
2. Surrogatsherausgabe (§ 285)
a) Regelungszweck und Anwendungsbereich des § 285
b) Voraussetzungen
c) Rechtsfolgen
3. Aufwendungsersatz (§ 284)
4. Lösung Fall 48
§ 13 Schuldnerverzug und Gläubigerverzug
I.Der Schuldnerverzug (§ 286)
1. Begriff und Bedeutung des Schuldnerverzugs
2. Voraussetzungen
a) Wirksamer, fälliger und durchsetzbarer Anspruch
b) Nichtleistung
c) Mahnung
d) Entbehrlichkeit der Mahnung (§ 286 Abs. 2)
e) Entgeltforderungen (§ 286 Abs. 3)
f) Vertretenmüssen (§ 286 Abs. 4)
g) Keine Beendigung des Schuldnerverzugs
3. Rechtsfolgen
a) Ersatz von Verzögerungsschäden (§§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286)
b) Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden (§ 288)
c) Haftungsverschärfungen zulasten des Schuldners im Verzug (§ 287)
4. Abweichende Vereinbarungen
II.Der Gläubigerverzug (§§ 293-304)
1. Grundlagen und Funktionen
2. Voraussetzungen des Gläubigerverzugs
a) Wirksamer und erfüllbarer Anspruch
b) Leistungsfähigkeit des Schuldners (§ 297)
c) Ordnungsgemäßes Angebot oder Entbehrlichkeit des Angebots
d) Nichtannahme der Leistung
e) Kein vorübergehendes Annahmehindernis
3. Rechtsfolgen
a) Haftungsmilderungen
b) Übergang der Leistungsgefahr (§ 300 Abs. 2)
c) Gegenleistungsgefahr (§ 326 Abs. 2 S. 1 1. Alt.) und Ausschluss des Rücktrittsrechts (§ 323 Abs. 6 2. Alt.)
d) Ersatz von Mehraufwendungen (§ 304)
III. Lösung Fall 51
Teil IV Verbraucherrecht
§ 14 Verbraucherrecht im Allgemeinen Schuldrecht
I.Grundlagen des Verbraucherschutzrechts
1. Entwicklung und Zweck des Verbraucherschutzrechts
2. Systematik bzw Regelungsorte
3. Die zentralen Regulierungsinstrumente: Informationspflichten und Widerrufsrechte
a) Informationspflichten
b) Widerrufsrechte
II.Anwendungsbereich des Verbraucherschutzrechts
1. Die Legaldefinition des Verbrauchervertrags in § 310 Abs. 3
2. Anwendbarkeit der §§ 312a ff
a) Entgeltlichkeit der Leistung: Grundsätzliches
b) Standardsituationen: Unternehmer erbringt vertragstypische Leistung
c) Umgekehrte Leistungsrichtung: Verbraucher erbringt die vertragstypische Leistung
d) Sonderproblem: Bürgschaftsverträge
3. Einschränkungen beim Anwendungsbereich (§ 312 Abs. 2 bis Abs. 7)
a) Minimalanwendungsbereich (§ 312 Abs. 2)
b) Eingeschränkter Anwendungsbereich (§ 312 Abs. 3, § 312 Abs. 4 S. 2)
c) Weitere Sonderregime (§ 312 Abs. 5, 6 und 7)
III.Verbraucherverträge: Allgemeine Regelungen (§§ 312, 312a, 312k)
1. Hintergrund, Systematik und Zweck der Regelungen
2. Allgemeine Pflichten und Grundsätze (§ 312a)
3. § 312k: Einseitig zwingender Charakter, Umgehungsverbot, Beweislast
IV.Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr (§§ 312i, 312j)
1. Hintergrund, Systematik und Zweck der Regelungen
2. § 312i: Allgemeine Pflichten im elektronischen Rechtsverkehr (auch im b2b-Bereich)
3. § 312j: Besondere Pflichten im elektronischen Rechtsverkehr gegenüber Verbrauchern
V.Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (AGV) und Fernabsatzverträge (FAV): §§ 312b-312h
1. Regelungszweck und gesetzliche Systematik
2.§ 312b: Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (AGV)
a) Überblick
b) Geschäftsräume (§ 312b Abs. 2)
c) Die Tatbestände des § 312b Abs. 1
3.§ 312c: Fernabsatzverträge (FAV)
a) Überblick
b) Fernabsatzverträge (§ 312c Abs. 1 und 2)
4.§§ 312d, 312e iVm Art. 246a, 246b EGBGB: Informationspflichten
a) Überblick und Systematik
b) § 312d Abs. 1: AGV und FAV, die keine Verträge über Finanzdienstleistungen sind
5.§ 312g: Widerrufsrecht bei AGV und FAV
a) Hintergrund und Systematik
b) Ausnahmenkatalog (§ 312g Abs. 2)
6. § 312h: Textform bei Kündigung von Dauerschuldverhältnissen
VI.Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen (§§ 355-361)
1. Regelungszweck
2. Gesetzliche Systematik
3. Die Rechtsnatur des Widerrufsrechts
4.Die Ausübung des Widerrufsrechts
a) Inhalt und Form der Widerrufserklärung (§ 355 Abs. 1 S. 2)
b) Widerrufsfrist (§ 355 Abs. 2 S. 1 und Modifikationen)
c) Sonderbestimmungen für das Widerrufsrecht (§ 356 und §§ 356a-356e)
5.Rechtsfolgen des Widerrufs
a) Umwandlung des Vertrags in ein Rückabwicklungsverhältnis (§ 355)
b) Einzelheiten der Rückabwicklung bei FAV und AGV (§ 357)
c) Einzelheiten der Rückabwicklung bei anderen Vertragstypen (§§ 357a-357d)
6.Verbundene und zusammenhängende Verträge (§§ 358-360)
a) Regelungszweck und Systematik
b) Mit dem widerrufenen Vertrag verbundene Verträge (§§ 358-359)
c) Zusammenhängende Verträge (§ 360)
7. Treu und Glauben im Widerrufsrecht
VII. Besonderheiten bei der Klauselkontrolle (§ 310 Abs. 3)
1. Fiktion der Stellung Allgemeiner Geschäftsbedingungen durch den Unternehmer (§ 310 Abs. 3 Nr 1)
2. Klauseln, die zur einmaligen Verwendung bestimmt sind (§ 310 Abs. 3 Nr 2)
3. Begleitumstände des Vertragsschlusses bei der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 und 2
VIII. Lösung Fall 54
§ 15 Haftung aus geschäftlichem Kontakt (culpa in contrahendo)
I.Die Grundlagen des Rechtsinstituts
1. Entstehung und Problematik
2. Dogmatische Einordnung
3. Grundsätzliches zu Pflichten und Haftung
II.Die Haftungsvoraussetzungen im Einzelnen
1. Die gesetzlich geregelten Fälle
a) Aufnahme von Vertragsverhandlungen
b) Vertragsanbahnung
c) Ähnliche geschäftliche Kontakte
d) Einbeziehung „vertragsfremder“ Dritter
2. Pflichtwidrigkeit und Verschulden
3. Schaden und Schutzbereiche
III.Rechtsfolgen der schuldhaften Verletzung vorvertraglicher Pflichten
1. Allgemeines
2. Vertrauens- und Nichterfüllungsschaden
3. Schadensersatzformen
4. Mitverschulden
IV.Das Verhältnis zu anderen Regelungskomplexen
1. Willensmängel
2. Gewährleistung
3. Verletzung vertraglicher Schutzpflichten
4. Verhältnis zum Minderjährigenschutz
V. Lösung Fall 58
§ 16 Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB)
I. Die Entwicklung des Rechtsinstituts
II. Der Tatbestand der Geschäftsgrundlagestörung
III.Die Störung der Geschäftsgrundlage im Einzelnen
1. Grundsätzliches
2. Nachträgliche Störungen der Geschäftsgrundlage (§ 313 Abs. 1)
3. Ursprüngliche Geschäftsgrundlagestörungen (§ 313 Abs. 2)
IV.Rechtsfolgen von Störungen der Geschäftsgrundlage
Читать дальше