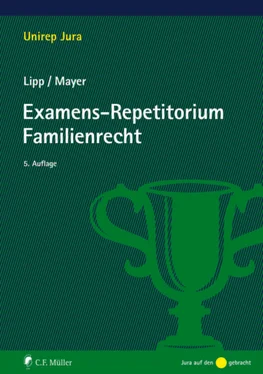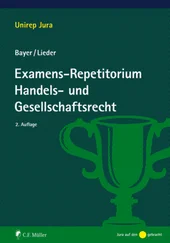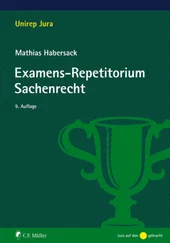[18]
Verordnung (EU) 2016/1103 des Rates zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen des ehelichen Güterstands vom 24.6.2016, ABl. EU 2016 Nr. L 183, S. 1; abgedruckt bei Jayme/Hausmann , Internationales Privat- und Verfahrensrecht, 192018, Nr. 33.
[19]
Verordnung (EU) 2016/1104 des Rates zur Durchführung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen güterrechtlicher Wirkungen eingetragener Partnerschaften vom 24.6.2016, ABl. EU 2016 Nr. L 183, S. 30; abgedruckt bei Jayme/Hausmann , Internationales Privat- und Verfahrensrecht, 192018, Nr. 39.
[20]
Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen vom 18.12.2008, ABl. EU 2009 Nr. L 7, S. 1; abgedruckt bei Jayme/Hausmann , Internationales Privat- und Verfahrensrecht, 192018, Nr. 161.
[21]
Haager Protokoll über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 23.11.2007, ABl. EU 2009 Nr. L 331, S. 19; abgedruckt bei Jayme/Hausmann , Internationales Privat- und Verfahrensrecht, 192018, Nr. 42.
[22]
Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern vom 19.10.1996, BGBl. II 2009, S. 603; abgedruckt bei Jayme/Hausmann , Internationales Privat- und Verfahrensrecht, 192018, Nr. 53.
[23]
Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung vom 25.10.1980, BGBl. II 1990, S. 207; abgedruckt bei Jayme/Hausmann , Internationales Privat- und Verfahrensrecht, 192018, Nr. 222.
[24]
Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung, ABl. EU 2003 Nr. L 338, S. 1; abgedruckt bei Jayme/Hausmann , Internationales Privat- und Verfahrensrecht, 192018, Nr. 162.
[25]
Neufassung der Brüssel IIa-VO in der Verordnung (EU) 2019/1111 über die Zuständigkeit, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und über internationale Kindesentführungen, ABl. EU 2019 Nr. L 178, S. 1; in Kraft seit 22.7.2019.
[26]
EMRK vom 4.11.1950, BGBl. II 1952, S. 685, 953. Zur Berücksichtigung der Entscheidungen des EGMR durch innerstaatliche Organe, insb. deutsche Gerichte, vgl. BVerfG, FamRZ 2004, 1857 (Art. 8 EMRK, Art. 6 GG).
[27]
ABl. EU 2010 Nr. C 83, S. 389.
[28]
Näher dazu Gernhuber/Coester-Waltjen , Familienrecht, 72020, § 3 Rn. 28–30. Zur Anwendbarkeit des allgemeinen Schuldrechts (insb. § 280) auf familienrechtliche Paarbeziehungen vgl. Mayer , Haftung und Paarbeziehung, 2017, S. 55 ff.
[29]
Vgl. dazu Mayer , FamRZ 2019, 1969.
[30]
Beachte: Ein einseitiger Verzicht ist bei Einreden und Gestaltungsrechten möglich, MüKoBGB/ Schlüter , 82019, § 397 Rn. 19.
[31]
Zu § 1353 Abs. 1 etwa Palandt/ Brudermüller , BGB, 792020, § 1353 Rn. 3.
[32]
Zur heutigen Situation MüKoBGB/ Roth , 82019, § 1353 Rn. 18 ff., 40 ff. Dezidiert a.A. Mayer , Haftung und Paarbeziehung, 2017, S. 140 ff., und unten Rn. 128 ff.
[33]
BVerfG, NJW 2008, 1287.
[34]
Für ein auch zwangsweise durchsetzbares Recht des Kindes auf Umgang aber z.B. OLG Brandenburg, FamRZ 2005, 293 (betreuter zweistündiger Umgang alle drei Monate). Das BVerfG, NJW 2008, 1287, hat die Entscheidung aufgehoben und hält eine erzwungene Umgangsverpflichtung der Eltern nur dann für möglich, wenn (ausnahmsweise) „hinreichende Anhaltspunkte“ dafür vorliegen, der erzwungene Umgang könne dem Kindeswohl dienlich sein; näher dazu Rn. 726.
[35]
Das gilt nicht erst für das Vollstreckungsrecht, auch wenn der Gesetzgeber hierfür Regelungen getroffen hat, vgl. § 888 Abs. 1 S. 1 ZPO (unvertretbare Handlungen, die „ausschließlich von dem Willen des Schuldners“ abhängen); gleiches gilt für § 120 Abs. 3 FamFG sowie §§ 89, 90 FamFG. Zu diesem Problem noch genauer Rn. 128 ff.
[36]
BVerfG, NJW 1968, 2233 (2235).
[37]
MüKoBGB/ Wagner , 72017, § 823 Rn. 363 m.w.N.
[38]
Vgl. dazu und zu einem alternativen Lösungsvorschlag über einen allgemein-schuldrechtlichen Schadensersatzanspruch Mayer , FamRZ 2019, 1969, und unten Rn. 727 f.
[39]
Zu Notwendigkeit und Grenzen einer richterlichen Inhaltskontrolle von Eheverträgen vgl. Rn. 286 ff.
[40]
Nur durch gerichtliche Entscheidung kann das Sorgerecht übertragen (§ 1671) oder eingeschränkt werden (§§ 1666 ff.).
[41]
Grenzen des Widerrufs ergeben sich nur aus Sicht der Persönlichkeit des Kindes (z.B. § 1632 Abs. 1, Abs. 4).
[42]
Das frühere Recht kannte die Verwirkung der „elterlichen Gewalt“ (§ 1680 urspr. F.; § 1676 i.d.F.d. GleichberG 1957); davon unberührt blieb aber das Elternrecht i.Ü.
[43]
Dazu Hammer , FamRZ 2005, 1209 m.w.N.; ders ., Elternvereinbarungen im Sorge- und Umgangsrecht, 2004, passim.
[44]
Zur Problematik der Bindung an Ehevereinbarungen vgl. MüKoBGB/ Roth , 82019, § 1353 Rn. 5 ff.; ausführlicher Rn. 147 f.
Erster Teil Grundlagen› § 2 Verfassungsrechtliche Implikationen
§ 2 Verfassungsrechtliche Implikationen
Inhaltsverzeichnis
I. „Ehe“
II. „Familie“
III. „Eltern“ und „Elternrecht“
14
Art. 6 GGstellt Eheund Familieunter den „besonderen Schutze der staatlichen Ordnung“ (Abs. 1)und erkennt die Pflege und Erziehung der Kinder als das „natürliche Recht“ der Elternan (Abs. 2 S. 1). Diese für das deutsche Ehe- und Familienrecht grundlegende Verfassungsvorschrift ist in ihrem Abs. 1 (Ehe und Familie) „weder durch einen Gesetzesvorbehalt noch auf andere Weise beschränkt“.[1] Die vorbehaltsloseGewährung in Art. 6 Abs. 1 GG lässt deshalb nur definierende (gestaltende) gesetzliche Regelungenzu (z.B. § 1353 Abs. 1), dagegen keine eingreifenden. Im Falle einer Rechtskollision kann sie nur durch Grundsätze mit Verfassungsrang beschränkt werden, also durch die Grundrechte anderer oder sonstige verfassungsrechtliche Prinzipien.[2] Ein qualifizierter Gesetzesvorbehaltliegt der Anerkennung des Elternrechts in Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG (staatliches Wächteramt) zugrunde.[3] Der Schutz der Verfassung entfaltet sich aber nur im Normbereichder Vorschrift, d.h. nur für die im Sinne des Rechts anerkannten „Ehen“, „Familien“ und „Eltern“. Aus der Einbeziehung in den Schutzbereich der Verfassungsnorm folgt freilich nicht schon, dass der daraus abzuleitende Schutz für alle Grundrechtsträger rechtlich identisch ausgestattet sein müsste. So genießt den Schutz des Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG nicht nur der rechtliche (§ 1592), sondern auch der biologische Vater eines Kindes insoweit, als der Gesetzgeber ihnen nicht unüberwindbare Hürden für den Zugang zum Elternrecht auferlegen darf. Das Verfahren zur Erlangung der rechtlichen Elternstellung muss deshalb auch für den biologischen Vater hinreichend effektiv ausgestaltet sein.[4] Das Elternrecht im Sinne dieser Vorschrift ist allerdings nur dem Vater im Rechtssinne zugeordnet.[5] Deshalb kann der biologische Vater neben einem rechtlichen Vater nicht gestützt auf Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG die gleichen Rechte für sich beanspruchen.
Читать дальше