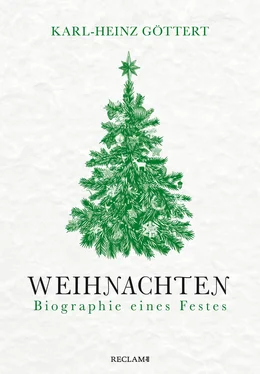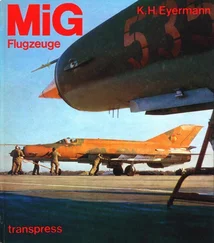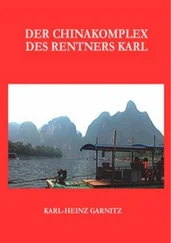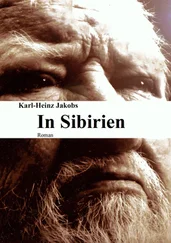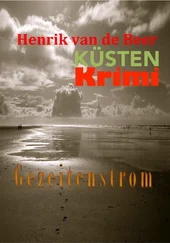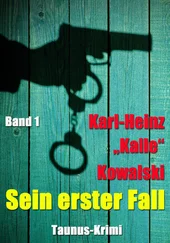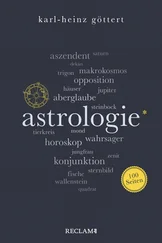Paulinus von Nola war der erste Senator, also ein wirklich Superreicher, der sein Vermögen stiftete. Er war beeinflusst von Priscillian, Bischof von Avila, einem berühmt-berüchtigten Asketen. Bischöfe entwickelten sich zu Spezialisten der Umgarnung, eine Art Drittmitteleintreibung in Zeiten der Spätantike. Vor allem Witwen waren die »Opfer«, was bei Neidern zu entsprechender Polemik führte – zum Beispiel zur Bezeichnung als »Ohrlöffel der Matronen« (mit solchen Ohrlöffeln entfernte man das Ohrenschmalz). Aber auch die »normalen« Reichen leisteten ihre Beiträge, wozu bei jedem Gottesdienst der Opfergang eingerichtet war, bei dem Spendenwillige ihren Beitrag zum Altar trugen und daraufhin unter namentlicher Nennung Applaus erhielten (was Hieronymus sarkastisch damit kommentierte, dass es sich nicht um ihren eigenen Reichtum handelte).
Das Christentum wuchs also, die aus dem Boden schießenden Kirchen entstammten den Geldbörsen reicher Spender. Doch etwas anderes lastete schwer auf dieser Entwicklung. Es gab keine Einigkeit über die theologischen Grundlagen. Im Gegenteil: Die frühe Kirche hatte zwar einen Abwehrkampf gegen heidnische Philosophen geführt – wie zum Beispiel Origenes gegen den Neuplatoniker Celsus, bei dem das Versprechen der Auferstehung nur Spott auslöste: »Das ist eine Hoffnung, die geradezu für die Würmer passend ist! Denn welche menschliche Seele dürfte sich wohl noch nach einem verwesten Leibe sehnen?« Und wenig später sollten die siegreichen Christen nach ihrer eigenen Verfolgung zur nicht weniger blutigen Heidenverfolgung übergehen, der zum Beispiel die ebenfalls neuplatonische Philosophin Hypatia zum Opfer fiel, als ein christlicher Mob sie nackt steinigte, ihren Leichnam anschließend zerstückelte und verbrannte. Aber die frühe Kirche kannte ebenfalls und zunehmend Abweichler, weil sich ohne »Haupt« die Dinge überall anders entwickelten. Es muss für Konstantin ein schwerer Schock gewesen sein, als er merkte, dass diese Kirche, auf die er so sehr setzte, in sich zerstritten war. Das Reich hatte er politisch geeint, er herrschte unangefochten. Und dann dieses Auseinanderfallen ausgerechnet bei denen, die er für die innere Befriedung so dringend brauchte.
Charakteristischerweise zeigte sich dieses Auseinanderfallen auch an dem damals wichtigsten Fest der Christenheit überhaupt: an Ostern. Es wurde, wie schon gesagt, teils am Wochentag der Auferstehung gefeiert, teils stets am Sonntag, was sich ja schließlich durchsetzte. Wer denkt, ein solches Nebeneinander müsse tolerierbar gewesen sein, täuscht sich in der Mentalität von Theologen, die ihre Existenz dafür aufs Spiel setzten, »richtig« zu feiern. Und dann setzte auch noch der Kampf um die Trinität ein, die Frage, wie es mit der Person Jesu als Sohn bestellt war. Der alexandrinische Presbyter (Priester) Arius hatte in diesem Punkt die Position eingenommen, dass Jesus von Gott »erschaffen« wurde, ihm also nicht wesensgleich, nur wesensähnlich war. Das lief auf einen »reinen« Monotheismus statt der Trinität von Vater, Sohn und Heiligem Geist hinaus – eine durchaus einleuchtende Erklärung, die ganz nebenbei einen der wichtigsten Einwände des Islam gegen das Christentum verhindert hätte. Sie wurde über ein ganzes Jahrhundert hinweg niedergerungen, mit viel Blutvergießen auf beiden Seiten.
Konstantin hatte dies also direkt vor Augen und reagierte. Er rief 325 eine Versammlung der gesamten Kirche ein, das erste ökumenische Konzil. Der Ort lag ganz in der Nähe seines Regierungssitzes Konstantinopel, in seinem Sommerpalais von Nicäa auf der anderen Seite des Bosporus, idyllisch gelegen am Iznik-See. Um die 300 Bischöfe kamen unter Erstattung der Reisekosten zusammen, darunter sieben aus dem Westen. Der Kaiser saß der Versammlung auf einem goldenen Sessel vor, griff in die Debatten ein und feierte am Ende sein 20-jähriges Dienstjubiläum, ehe er die Bischöfe reich beschenkt entließ – die bei ihm eingegangenen Briefe, in denen diese Bischöfe ihre Kollegen anschwärzten, hatte er zuvor einfach vernichtet. Alles schien in Ordnung. Ostern wurde auf Sonntag fixiert, auch die Modalitäten der Berechnung festgelegt. Arius wurde verurteilt und verbannt, heraus kam das Glaubensbekenntnis, das mit geringen Abwandlungen unverändert blieb, in der heutigen Formulierung: »Wir glauben an den einen Gott, / den Vater, den allmächtigen […] Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, / aus dem Vater geboren vor aller Zeit: / Gott von Gott, Licht vom Licht, / wahrer Gott vom wahren Gott, / gezeugt, nicht geschaffen, / eines Wesens mit dem Vater …« Durchgesetzt hatte sich dabei ein Diakon von Alexandria, der seinen aus Antiochia stammenden Kollegen Arius auf das Konzil begleitet hatte: Athanasius, der spätere Athanasius der Große. Niemand ahnte damals wohl, wie sehr sich die Entwicklung, die letztlich ein Streit zwischen den beiden Hotspots der Theologie darstellte, noch zuspitzen würde.
Denn Arius war zwar geschlagen, nicht aber der Arianismus. Die Partei, die auf dem Konzil die Opposition gestellt und aus politischen Rücksichten das Ergebnis (mit dem Glaubensbekenntnis) unterschrieben hatte, gewann Oberwasser, brachte Konstantins Schwester Konstantia auf ihre Seite. Das bedeutete »Reinigung«. Einer der wichtigsten Protagonisten in Nicäa, Athanasius, der 328 als eine Art Dank für seine Leistungen zum Patriarchen von Alexandria aufgestiegen war, wurde vom Kaiser abgesetzt und ins Exil nach Trier (also möglichst weit weg vom Geschehen) geschickt, Arius dagegen rehabilitiert. Mit welchen Bandagen gekämpft wurde, sieht man vielleicht an einem eher nebensächlichen Ereignis: Man suchte Athanasius zu verdächtigen, einen Widersacher ermordet zu haben, legte eine abgehackte Hand als Beweis vor, worauf Athanasius den »Ermordeten« unverletzt vorführte und zunächst einmal davonkam.
Selbst Konstantin sympathisierte mit den Arianern, ließ sich auf dem Sterbebett von einem arianischen Bischof taufen. Nach seinem Tod übernahmen die Söhne die Herrschaft: Der älteste Sohn Constantin II. erhielt Rom, sein Bruder Constantius II. Konstantinopel. Beide Kaiser suchten jeweils ihren Reichsteil aufzuwerten, gerieten aber auch sofort in Streit mit dem jüngsten Bruder Constans, der Constantin II. besiegte. Er war katholisch gesinnt, während Constantius II. zwischen Katholiken und Arianern vermittelte. Constans hätschelte den Klerus und betrieb eine rigide Verfolgung von Heiden und Juden, auch Constantius II. ging gegen die Heiden vor, bediente sich aber daneben weiterer Mittel, um seinen Ruhm zu erhöhen. 357 ließ er die Reliquien des Apostels Andreas und des Evangelisten Lukas in die Apostelkirche von Konstantinopel überführen. Nach dem Tod von Constans gab es im Römischen Reich mit Constantius II. wieder einen Alleinherrscher, der die Arianer unterstützte. Als er nach vielen unglücklichen Kämpfen gegen die Goten die Strategie änderte und das germanische Volk ins Reich aufnahm, wurden diese wie die meisten germanischen Völker später (die Vandalen in Nordafrika oder die Langobarden in Norditalien) Arianer – bis sich der Franke Chlodwig um 500, übrigens an einem Weihnachtsfest, in Reims katholisch taufen ließ.
Das junge Christentum führte also um die Lehre von der Natur Christi einen erbarmungslosen Kampf inklusive Mord und Totschlag. Der heidnische Historiker Ammianus Marcellinus berichtet äußerst kritisch über die »ständigen Kontroversen«, bei denen es nie zu einer Einigung kam, sondern nach seinem Eindruck der Streit um des Streites willen geführt wurde: »Scharen von Bischöfen hasteten dahin und dorthin zu ihren verschiedenen Synoden und desorganisierten so den öffentlichen Postdienst.« Athanasius als einer der Hauptangriffsführer ging fünfmal in die Verbannung und wurde fünfmal rehabilitiert.
Конец ознакомительного фрагмента.
Читать дальше