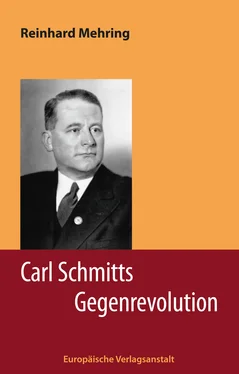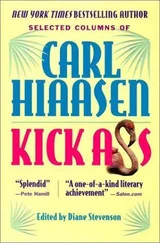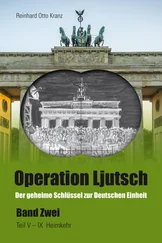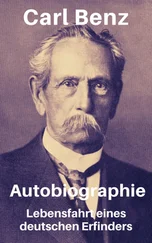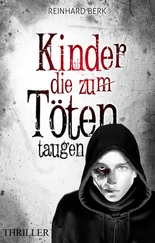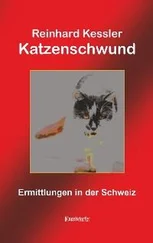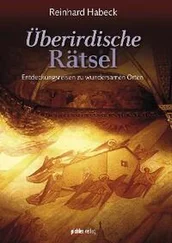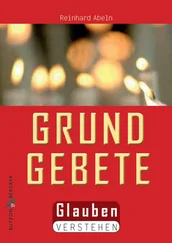Liest man den Ofterdingen mit Glauben und Liebe zusammen, so wollte Novalis Preußen irgendwie mit der Reichsidee verknüpfen. Ein solcher Transfer war aber unmöglich. Die Reichsinsignien lagen in Wien und eine Übergabe an Berlin war politisch wie konfessionell nahezu ausgeschlossen. Schmitts Befund, dass der Staatsbegriff und territorial-staatliche Separatismus, die Spannung zwischen Preußen und Österreich, auch eine Wiedergeburt des Reiches unter preußischen Vorzeichen ausschloss, war politisch berechtigt. Wenn Schmitt das 1933 ausführte, stellt sich die Frage, ob er den Nationalsozialismus als charismatische Wiedergeburt der Reichsidee betrachtete. Buchstäblich muss man das so sehen, obgleich Schmitt vorsichtig und vorbehaltlich formulierte; es könnte ernstlich so gedacht gewesen sein, war Schmitt doch ein religiöser Ekstatiker wie Novalis, der die religiösen Weihen suchte. Eine Verbindung Preußens mit der Reichsidee lehnte er aber für die Lage um 1800 ab und meinte dagegen mit Hegel, dass die Rettung Deutschlands vor Napoleon nur durch die preußischen Reformen auf dem Weg der Etatisierung erfolgen konnte. Diese Antwort der preußischen Reformen hat Novalis jedoch nicht mehr erlebt. Schmitt unterschied bei politischen Denkern zwischen Siegern und Verlierern. Es wäre aber übertrieben zu sagen, dass er Novalis als einen „Besiegten von 1798“ betrachtete. Dessen politische Schriften hatten überhaupt keine Chance. Die idealistische Verklärung des jungen Königspaars war damals auch wenig überzeugend. Der philosophische Chiliasmus des Novalis ist davon zwar nicht getroffen; Novalis war für Schmitt aber nicht zentral, weil er den philosophischen Idealismus mied und die Lage von 1798 in seiner Verfassungsgeschichte keine Rolle spielte.
V. Gegen den Anarchismus: Fritz Mauthner und Gustav Landauer im Visier
Die letzten Kriegsjahre, der Systemumbruch vom Kaiserreich zur Weimarer Republik und das Scheitern der ersten Ehe Schmitts sind aus den biographischen Quellen nicht detailliert greifbar. Die Ablehnung politischer Romantik und seine Option für Diktatur und Gegenrevolution sind aus den Schriften zwar grundsätzlich klar; seine genaue Wahrnehmung der politischen Lage in Bayern und im Reich ist im Umbruch aber kaum explizit. Schmitt argumentierte bereits indirekt mit den historischen Parallelen zur Moderne und Neuzeit: zur Lage nach 1815 und vor 1648. Er sprach von Wallenstein und Adam Müller, David Friedrich Strauss und Bakunin, statt sich zu Ludendorff oder Ebert, Liebknecht, Eisner oder Leviné klar zu positionieren. Es gibt auch nur wenige rückblickende Äußerungen zu den Akteuren des bayerischen Sonderwegs in die Weimarer Republik. Ob Schmitt etwa die Reichsexekution gegen Bayern und die Gewalt der Freikorps in der Bürgerkriegslage des Frühjahrs 1919 für richtig hielt, ist aus den damaligen Quellen kaum zu sagen. Rückblickende Äußerungen sind unzuverlässig. Auch einige späte Briefe an Hansjörg Viesel, in denen Schmitt sich über seine frühe Münchner Zeit äußert, bleiben vage. Viesel hatte sich über die Erwähnung von Otto Gross in der Politischen Theologie (PT 71) verwundert; Schmitt antwortet dazu 1973: „Sie, lieber Herr Viesel, sind also der Erste und Einzige, der – innerhalb eines halben Jahrhunderts! – das Zeichen bemerkt hat.“ 104Im Juli 1973 schreibt er ergänzend:
„Max Weber habe ich erst 1919 persönlich kennengelernt, in München, als Hörer seiner damaligen tumultarischen Vorlesungen und Mitglied seines Dozenten-Seminars (Kurt-Eisner-Zeit); Eisner ist als Modell des ‚Charisma‘ und der ‚charismatischen Legitimität‘ in Webers Soziologie eingegangen. Der von Jaspers und Theodor Heuss aufgebaute Max-Weber-Kult hat einer kritischen Würdigung dieses erstaunlichsten Falles politischer Theologie im Wege gestanden“. 105
Weber hatte zum Sommersemester 1919 den Lehrstuhl in München übernommen. Damals war Schmitt noch in der Heeresverwaltung tätig. Erst zum Wintersemester 1919/20 übernahm er seine erste feste Dozentur. Er besuchte damals Webers Veranstaltungen und klebte sich eine Teilnehmerkarte in sein Exemplar von Wirtschaft und Gesellschaft . Dazu ergänzte er handschriftlich: „Die intellektuelle Besorgnis, ein fremdes Charisma zu verkennen, war stärker als die existentielle Angst, das eigene Dasein zu verfehlen. (Dr. Toller, Eisner 1919)“ (TB 1915/19, 495) Weber las im Wintersemester seinen „Abriss der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“ und gab samstags ein Seminar „Soziologische Arbeiten und Besprechungen“. Am 21. Februar 1920 zählte Weber in einem Brief an Karl Vossler die regelmäßigen Teilnehmer des Dozentenseminars auf: Rothenbücher, Palyi, Carl Landauer, Christian Janentzky, Ernst von Aster, Friedrich Klausing und Schmitt. 106Wenn Schmitt rückblickend von der Eisner-Zeit sprach, zeigen sich Überformungen der Erinnerung: Weber veranstaltete das Dozenten-Seminar über ein Jahr nach Eisners Ermordung.
Spätestens seit der Politischen Theologie argumentierte Schmitt mit der historischen Parallele von 1848; er spiegelte die Lage der Weimarer Republik im Aufbruch des Vormärz und der Paulskirchen-Politik. Diesen nationalliberalen Weg zur Reichsgründung sah er im Licht des Ausnahmezustands von den extremen Polen der Revolution und Gegenrevolution her skeptisch; die Münchner Lage von 1918/19 spiegelte er verdeckt in der kleinen Parallele von 1848. Nur einmal (D 185) erwähnt er damals Landauers Ausgabe von Kropotkins Buch über Die französische Revolution . 107Diese Nennung war kein gezieltes metonymisches „Zeichen“, wie die Erwähnung von Otto Gross, steht aber für eine anarchistische Linie der Revolution – von Kropotkin zu Landauer – und die Aktualität der Fronten von 1848. Landauer gilt auch heute als einer der wichtigsten Vordenker und Akteure der Revolution. Das folgende Kapitel will zeigen, dass Autoren wie Landauer hinter Schmitts ständiger Erwähnung von Bakunin stehen und Schmitt intime Kenntnisse und Einsichten in diese Kreise hatte. Das zeigt sich schon am Interesse für Fritz Mauthner, dessen mystische Philosophie Landauer anarchistisch übersetzte.
1. Von Mauthner zu Landauer: von der Sprachskepsis zur anarchistischen Revolutionsmystik
Fritz Mauthner wurde 1849 in Böhmen geboren. In seinen späten Erinnerungen schildert er seine Sozialisation von seiner Dreisprachigkeit ausgehend. Die „Leichen dreier Sprachen“ 108– deutsch, tschechisch und hebräisch – trug er mit sich herum. In einem strikt säkularen, jüdischen und bürgerlichen Elternhaus geboren, in Prag aufgewachsen, war er durch eine kurze Phase jüdischer Identitätssuche und Bekehrung hindurchgegangen und früh zu einem „wütenden“ und „kriegerischen Atheismus“ 109gelangt. Nach einem geschäftlichen Bankrott des Vaters empfand er sich als Außenseiter. Mauthner betont den „nationalen Zwist“ zwischen Deutschen und Tschechen in Böhmen. An allen „Raufereien mit den Tschechen“ 110war er beteiligt. Nach 1866 optierte er kleindeutsch. Wie viele nationalliberale Deutsche und Juden sah er Bismarck als gewaltigen Modernisierer und Befreier aus den nationalistisch zerrissenen und instabilen Verhältnissen des Vielvölkerstaates an. Die Doppelmonarchie war für ihn keine kulturelle und politische Heimat. Nach dem Studium verließ er Prag, wie er schreibt, „für immer, um in Deutschland zu leben“. 111Das Basisfaktum seiner Biographie ist diese Entscheidung für das deutsche Kaiserreich. Es war in erster Linie eine Entscheidung für deutsche Kultur und politische Ordnung, Modernität und prosperierende Stabilität.
Mauthner verachtete den zeitgenössischen universitätsphilosophischen Betrieb und verstand sich primär als Dichter. Von seinen dichterischen Produktionen gelangte er über die Literatur- und Theaterkritik zur Sprachkritik. In Berlin wurde er ein erfolgreicher Literaturkritiker und schrieb dort in den 1890er Jahren seine Beiträge zur Kritik der Sprache . Mauthner suchte die Sprache vom Zwang sozialer Konventionen zu emanzipieren und in eine sprachlose Mystik und unmittelbare Präsenzerfahrung zu überführen. Diese Utopie mystischer Unmittelbarkeit trennte ihn trotz vieler Gemeinsamkeiten von der „fiktionalistischen“ Philosophie des Neukantianers Hans Vaihinger. Sein Spätwerk, seine vierbändige Geschichte des Atheismus, endete mit einer Absage ans Christentum und dem Etikett einer „gottlosen Mystik“.
Читать дальше