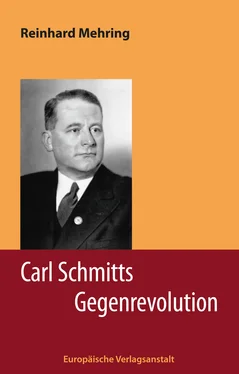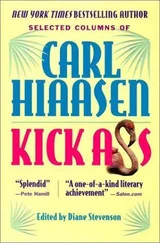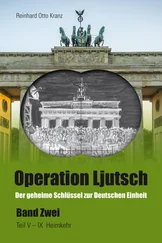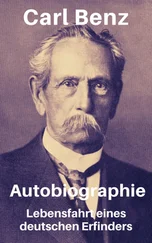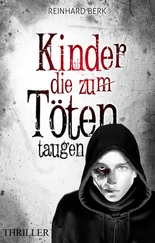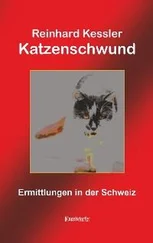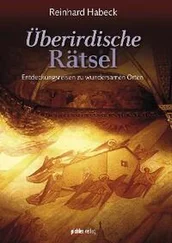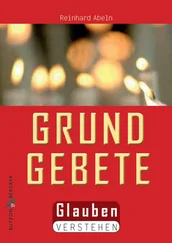Seine damaligen Tagebücher zeigen eine krasse Diskrepanz von Wunsch und Willen, zivilem Habitus und militärischer Antwort. Schmitt war zwischen staatlicher „Autorität“ und Schwabinger „Anarchie“ hin und her gerissen und wusste oft selbst nicht genau, wo er stand. Am 6. September 1915 notierte er in sein Tagebuch:
„Um 8 Uhr war ich bereit, Selbstmord zu begehen, in der Welt der Nacht und in der Stille zu versinken, mit ruhiger Überlegenheit; dann dachte ich nur daran, in der Welt Karriere zu machen. Einige Stunden später war mir alles gleichgültig und ich wollte gerne Soldat werden – es ist zum Verrücktwerden, diese Zusammenhanglosigkeit; was soll ich tun? Ich werde mich in einer Stunde vor Wut über meine Nichtigkeit erschießen.“ (TB 1915/19, 125)
Einen Tag später notierte er dann:
„Nachmittags: Bericht über das Belagerungs-Gesetz machen. Begründen, dass man den Belagerungszustand noch einige Jahre nach dem Krieg beibehält. Ausgerechnet ich! Wofür mich die Vorsehung noch bestimmt hat.“ (TB 1915/19, 125)
Die Rede von „Vorsehung“ ist hier zweifellos ironisch. Dennoch lässt sich von einer momentanen Erfassung einer Lebensaufgabe sprechen. Schmitts ganzes Werk konstatiert und propagiert einen Verfassungswandel vom liberalen Rechtsstaat zum autoritären und diktatorischen Exekutivstaat. Schmitt beginnt damals auch sogleich mit Studien zur Begriffs- und Verfassungsgeschichte der Diktatur. Parallel schreibt er aber für die – von der befreundeten Hamburger Verlegerfamilie Eisler herausgegebene – Zeitung Die Hamburger Woche anonyme Artikel im Spiegel von Presseberichten: satirische Entlarvungen und Zeugnisse panischer Ablehnung des Krieges und des „Militarismus“. Seine Auslegung der Nordlicht-Dichtung des befreundeten expressionistischen Dichters Theodor Däubler schlägt apokalyptische Töne an. Damals kommt Schmitt mit dem bedeutenden Literaturkritiker Franz Blei in freundschaftlichen Kontakt, der bis 1933 anhält. In Bleis esoterischer Zeitschrift Summa publiziert er eine „scholastische Erwägung“ zur „Sichtbarkeit der Kirche“, die sich im Dualismus von Staat und Kirche, Macht und Recht, auf die Seite der Kirche zu schlagen scheint. 1919 folgt mitten in die Münchner Revolutionslage hinein das Buch Politische Romantik , das auf die revolutionären Gesinnungsethiker von 1918/19 zielt.
An der Handelshochschule las Schmitt damals über die Verfassung des deutschen Reiches und Geschichte der politischen Ideen, über Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht sowie das Betriebsrätegesetz. Intensiv setzte er sich mit Marxismus und Bolschewismus auseinander. Der Untertitel seiner Monographie von 1921 über das Rechtsinstitut der Diktatur lautet: „von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf“. Dieser Untertitel ist antithetisch gedacht: Schmitt verteidigte den „kommissarischen“ Einsatz der Diktatur gegenüber der bolschewistischen Perversion des Rechtsinstituts zum selbstverständlichen Mittel des Klassenkampfes. Er unterschied Ausnahmezustand und Normalzustand und rechtfertigte politische Souveränität durch die Ordnungs- und Friedensfunktion, den Ausnahmezustand zu beenden und einen Normalzustand zu stabilisieren. Er verband Ausnahmezustand und Normalzustand mit Anarchie und Autorität und stellte sich in die „Gegenrevolution“. Die Gegenwart parallelisierte er mit der Lage um 1848 und identifizierte sich dabei – ab 1922, anstelle neuerer französischer Autoren – mit dem spanischen Gegenrevolutionär Donoso Cortés, der „von der Legitimität“ oder vom monarchistischen Legitimismus „zur Diktatur“ geschritten war und die Diktatur als antiliberale und gegenrevolutionäre Antwort bejaht hatte. Diese Maske oder Rolle des Gegenrevolutionärs hielt Schmitt in den folgenden Jahren fest. 1934 stilisierte er sich dann erneut als Soldat und Retter des Staates, als ein zweiter Bismarck hinter dem „Ersatzkaiser“, wenn er für die Epoche der Weimarer Republik konstatierte:
„Es ist der deutschen Reichswehr gelungen, unter der Führung des Reichspräsidenten und ihrer militärischen Leitung eine parteipolitisch neutrale Gewalt zu bilden und auf diese Weise, in Zeiten offenen oder latenten Bürgerkriegs, durch das gefährliche Stadium eines […] Pluralismus hindurch, den deutschen Staat zu halten. Von der staatsrechtlichen Seite her wurde das durch eine aus staatspolitischem Verantwortungsbewusstsein und klarer Erkenntnis der konkreten Verfassungslage entstandene staatsrechtliche Konstruktion des Reichspräsidenten als des Hüters der Verfassung ermöglicht, mit einer sinnvollen Auslegung sowohl des Verfassungsbegriffs wie der außerordentlichen Befugnisse des Art. 48. Wie damals während der Konfliktszeit der preußische König, so fand jetzt ein preußischer Generalfeldmarschall, aus seiner seinsmäßigen Verbundenheit mit dem preußisch-deutschen Soldatenstaat heraus, in schweigender Sicherheit den Weg, der einen Übergang zu anderen Verfassungszuständen eröffnete.“ (SZZR 47)
6. Spiegel der Politischen Romantik
Schmitt war also ein intimer Kenner der Münchner Bohème und spiegelte seine Lage in historischen Parallelen. Als Jurist mied er die direkte politische Parteinahme. Es ist deshalb nicht genau geklärt, wem er damals persönlich begegnete. Die gefährlichste Phase der Münchner Räterevolution: die kommunistische Rätediktatur (Leviné, Levien, Axelrod) von Mitte bis Ende April 1919, erlebte er in der Münchner Stadtkommandantur. Er soll damals in persönliche Lebensgefahr geraten sein, hat sich darüber aber nicht schriftlich geäußert. Als Jurist hatte er selbstverständlich Bedenken gegen Selbstjustiz. In seinem Buch über Die Diktatur erklärte er, dass „das Wesen des Notwehrrechtes darin besteht, dass durch die Tat selbst über seine Voraussetzungen entschieden wird“ (D 179). Nur in einer Fußnote zitierte er einen „Aufruf der kommunistischen Revolutionsleitung in Duisburg“ zum Standrecht und eine Bemerkung des Reichswehrministers: „‚Da finden Sie das neue Staatsrecht‘. ‚Da kommt das Erschießen fast vor dem Urteil, möchte man meinen.‘“ (D 177) Wenn Schmitt einen Reichswehrminister mit rechtstaatlichen Bedenken gegen das kommunistische Standrecht zitiert, verteidigt und kritisiert er die Niederschlagung und Aburteilung der Münchner Rätediktatur gleichermaßen.
Schmitt hatte 1919/20 in München persönlichen Kontakt zu Max Weber. Er hörte Vorlesungen und Vorträge und saß in Webers Dozentenseminar. Der genaue Umfang dieser Kontakte ist nicht ermittelt. Seine – wahrscheinlich vor Kriegsende abgeschlossene – Politische Romantik erschien Anfang 1919 Monate vor Webers Münchner Rede Politik als Beruf im Druck. In erster Annäherung lässt sich die Absage an die zeitgenössischen Romantiker mit Webers Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungspolitikern vergleichen: Schmitt wirft den politischen Romantikern eine ideologische Orientierung und mangelnden Realismus vor. Wo er „Romantik“ exorziert, spricht Weber, auch unter dem Eindruck des Toller-Prozesses, 66von verantwortungsloser „Gesinnung“. Weber lehnte „Gesinnungen“ zwar nicht pauschal ab, kritisierte die reine Gesinnungsethik aber konsequentialistisch. Von dieser Rede unterschied sich Schmitts Kritik schon durch das geistesgeschichtliche Gewand.
Die Monographie Politische Romantik gehört in die katholische oder katholisierende Phase, die spätestens 1925 mit der zweiten Fassung des Essays Römischer Katholizismus und politische Form endete. Unter dem Eindruck des Weltkriegs neigte Schmitt religiöser Apokalyptik zu. Seine Politische Romantik unterscheidet zwischen Gegenrevolution und ästhetisierender Romantik und richtet sich gegen romantische Auffassungen der „organischen“ Staatslehre. In die Endphase des Ersten Weltkriegs hinein korrigiert Schmitt die Fahnen. Schmitt kritisiert die politische Romantik exemplarisch am „Typus“ und Beispiel Adam Müllers. Novalis und Friedrich Schlegel zieht er nur ergänzend heran. Zwei Müller-Kapitel umklammern zwei Kapitel zur „Struktur des romantischen Geistes“. Schmitt übernimmt zwar polemische Topoi von Hegels Romantikkritik; Hegel konzentrierte sich aber auf Schlegel und führte die romantische Auslegung moderner Subjektivität philosophiegeschichtlich auf den „subjektiven Idealismus“ Fichtes zurück; Schmitt verlagert die Herleitung dagegen von Kant und Fichte auf Descartes und Malebranche und definiert die Romantik eigenwillig als „subjektiven Occasionalismus“ (PR 23f, 140f, 147). Er verwirft nicht nur Kant und die Folgen, sondern den neuzeitlichen Rationalismus insgesamt. Schmitt übernimmt zwar fast alle Aspekte von Hegels Romantikkritik; er kritisiert den Typus des Romantikers moralistisch wie Hegel als eitlen, ästhetizistischen Bourgeois, der sich an die Stelle Gottes setzt, betrachtet die Romantik aber darüber hinaus auch als eine pseudokonservative „Reaktion gegen den modernen Rationalismus“, die die „höchste Realität“ der alten Metaphysik, das vorreflexive Sein Gottes, durch moderne Ideen von „Volk“ und „Geschichte“ ersetzte. Mit der Formel vom „subjektiven Okkasionalismus“ streicht er die Epigonalität der Romantik als „Reaktionsform“ (PR 84) heraus. So profiliert er die katholische Kirche, und ihre Ontologie und Theologie, der er nahe steht, gegen die Romantik.
Читать дальше