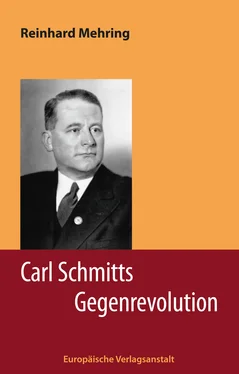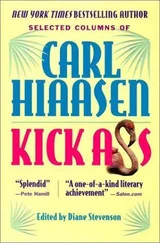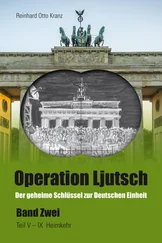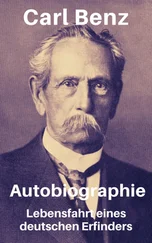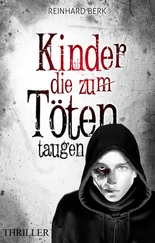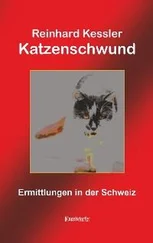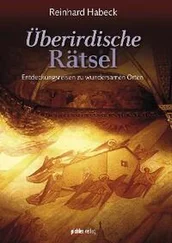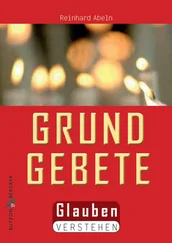Solche und ähnliche Formulierungen finden sich in der Verfassungslehre vielfach. Schmitts Kampf für eine systematische Auslegung der Verfassungsgesetze von den substantiellen „Grundentscheidungen“ her klingt aber im Zitat schon ebenso an wie eine leise Stigmatisierung der Rolle der Parteien, Kirchen und sozialistischen Bewegung bei der Formulierung des heterogenen Verfassungskompromisses. Es ist hier nicht weiter zu zeigen, wie Schmitt die Systematik des „bürgerlichen Rechtsstaats“ nach 1928 in Richtung auf einen „autoritären“ Exekutivstaat dekonstruierte und die tragenden „rechtstaatlichen Bestandteile“ der modernen Verfassung – den rechtsstaatlichen Gesetzesbegriff, Grundrechte und die liberale Gewaltenunterscheidung – der Reihe nach abbaute. Hier ist zunächst nur zu fragen, was er von der „existentiellen Totalentscheidung des deutschen Volkes“ im Jahre 1918/19 dachte.
5. Münchner Umbrucherfahrung
Schmitt lebte von 1915 bis 1921 in München. Er war 1915, nach Abschluss des 2. juristischen Staatsexamens, als Soldat und Verwaltungsjurist ins Stellvertretende Generalkommando München gewechselt und erlebte dort noch das Kriegsende sowie die Räterevolution bis zum Sommer 1919 als Heeresjurist. In München schlug hier für wenige Wochen und Monate die Stunde des „dritten Wegs“ und anarchistischen Experiments mit der Idee der unmittelbaren und „permanenten Demokratie“. In Memoiren wurde sie verspottet und verklärt, die Forschung idealisierte sie gerne demokratietheoretisch. Der Literaturkritiker Volker Weidermann 60dramatisierte die Ereignisse unlängst leicht fiktionalisierend und charakterisierte einige der Akteure – u.a. Eisner und Landauer, Toller und Oskar Maria Graf – dabei als politische „Träumer“, die in der zweiten Phase der Revolution, nach Eisners Ermordung, von den Kommunisten und Bolschewisten gestürzt und nach der Reichsexekution dann von der Gegenrevolution ermordet, hingerichtet oder ins Gefängnis gebracht wurden. Weidermann lässt Hitler als „Ersatzbataillonsrat“ und Erben der Revolution auftreten, der zwar „nicht offen gegen die Räteregierung opponiert“ 61hatte, sich aber im Dunstkreis der Thule-Gesellschaft antisemitisch radikalisierte. Für die gegenrevolutionäre Wendung des Münchner Gefreiten Hitler hätte er auch auf Schmitt verweisen können, wie dies Nicolaus Sombart 62schon vor Jahrzehnten tat: Auch Schmitt war in München als Soldat vor Ort nachhaltig von den Erfahrungen des Systemumbruchs, von Revolution und Gegenrevolution geprägt.
Michael Brenner 63zeigte eindringlich, dass „jüdische Revolutionäre“ – Eisner, Landauer, Mühsam, Toller, Leviné u.a. – 1918/19 zwar tatsächlich zentrale Akteure waren; sie hatten überwiegend aber mit dem Judentum gebrochen, den jüdischen Messianismus zur Revolutionsutopie säkularisiert und waren für das Münchner Judentum keineswegs typisch. Das Münchner Judentum distanzierte sich zwar mehrheitlich klar von der Revolution, wurde dennoch für die Ereignisse verantwortlich gemacht. Die Räterepublik wurde als „jüdische Revolution“ denunziert und stigmatisiert. Bald nach der Niederschlagung der zweiten, radikalen Phase vom Frühjahr 1919 entstand eine Pogromstimmung, die zu Standgerichten, politischer Justiz und Ausweisungen führte. Diese extremistische Radikalisierung mündete über Gustav von Kahr in den Hitler-Putsch vom November 1923.
Für die Jahre von 1917 bis 1922 sind leider nur wenige Ego-Dokumente Schmitts bekannt. Erstaunlich selten äußerte sich Schmitt auch rückblickend zu seiner damaligen Lage und Wahrnehmung der Umbruchzeit. Aggressiv gegenrevolutionär empfand und agierte er damals vermutlich noch nicht. So ist beachtlich, dass er sich 1920 (TB 1921/24, 75) für die juristische Vertretung an den Rechtsanwalt Max Hirschberg wandte, 1922 aber dann den Rechtsanwalt wechselte (TB 1921/24, 87). Immerhin war er 1920 offenbar bereit, sich von einem jüdischen Anwalt vertreten zu lassen, der exponierte Akteure der Münchner Revolution, wie Felix Fechenbach, den Privatassistenten Eisners, energisch verteidigte. 64Nach dem Ausscheiden aus dem Militärdienst begann er damals zum Wintersemester 1919/20 seine erste feste Dozentur an der Münchner Handelshochschule. Sein Straßburger Mentor Fritz van Calker war inzwischen an die Technische Universität gewechselt, an der Universität lehrten damals u.a. Karl Rothenbücher und Hans Nawiasky. Die Rolle der Juraprofessoren im Systemumbruch lässt sich in München also gleich für drei Hochschulen untersuchen. Bei Stolleis 65ist knapp nachzulesen, dass die meisten Juraprofessoren die Geltung der Weimarer Verfassung damals klaglos akzeptierten. Vielleicht sollte man aber zwischen einem Establishmentdiskurs der etablierten Hochschullehrer und der Lage des akademischen Nachwuchses unterscheiden. Einige etablierte Hochschullehrer waren im Konstitutionalisierungsdiskurs des Systemwechsels engagiert. Sie beteiligten sich an der öffentlichen Diskussion und wirkten am Verfassungsprozess der Nationalversammlung und den Versailler Verhandlungen mit. Das gilt etwa für Weber, Preuß, Rothenbücher oder auch Moritz Bonn, der Schmitt als Direktor an die Handelshochschule geholt hatte. Schmitt dagegen hielt sich als junger Nachwuchswissenschaftler, der noch nicht an eine Universität berufen war, in der Formierungsphase der Republik mit Positionierungen zurück. Erst 1924 trat er in Jena auf der Tagung der Staatsrechtslehrervereinigung mit einem Paukenschlag aus seiner Deckung hervor: mit seiner extensiven Auslegung der Diktaturbefugnisse des Reichspräsidenten. Seine Positionierung von 1924 unterschied sich dabei von der späteren, noch extensiveren Auslegung im Präsidialsystem. Die verfassungshistorische Programmschrift Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches spricht 1934 dann mit nationalsozialistischem Akzent rückblickend von einem Sieg des Bürgers über den Soldaten . Nimmt man dies wörtlich, so lautet die simple Antwort auf die Frage nach der Revolutionserfahrung von 1918/19: Schmitt betrachtete den Systemwechsel aus der Perspektive des Münchner Soldaten als „Sieg des Bürgers“. Mit seinem Engagement für das Dritte Reich wünschte er ein soldatisches System irgendwie zu restaurieren.
So einfach liegt die Antwort allerdings nicht. Schmitt war niemals ein überzeugter Monarchist und Militarist gewesen. Seit 1915 führte er ein chaotisches Doppelleben zwischen Café und Kaserne. Er verkehrte mit expressionistischen Dichtern, religiösen Apokalyptikern und jüdischen Intellektuellen und war habituell alles andere als ein soldatischer Gegenrevolutionär. Er war allerdings, formelhaft gesprochen, ein „Etatist“ und Anwalt des „starken Staates“. Seine unmittelbare Revolutionserfahrung ist mit den Titeln der beiden großen Bücher treffend bezeichnet, die 1919 und 1921 im Münchner Verlag Duncker & Humblot erschienen: Politische Romantik und Die Diktatur : Diktatur versus Romantik! Das Thema des Belagerungs- und Ausnahmezustands wurde ihm 1915 zunächst dienstlich gestellt. Sein Vorgesetzter im Generalkommando war Hauptmann Christian Roth, ein exponierter Gegenrevolutionär, der 1920/21 bayerischer Justizminister unter Gustav von Kahr wurde. Es gibt also eine klare Kontinuitätslinie der Gegenrevolution, obgleich Schmitt 1920 in einem Leserbrief gegen Angriffe der Frankfurter Zeitung erklärte: „Die Abteilung Roth war kein Scharfmacherbüro und Dr. Roth alles andere als ein bornierter Militarist.“ (TB 1915/19, 519) Diese Solidaritätserklärung war zweifellos apologetisch und wird von Historikern schwerlich akzeptiert werden. Wie auch immer man aber die Diktaturpolitik des Militärs bewertet, steht doch eindeutig fest: Die Diktatur war seit 1915 Schmitts verfassungspolitisches Lebensthema, und sie begegnete ihm zunächst als militärischer Auftrag im Weltkrieg.
Читать дальше