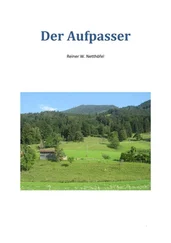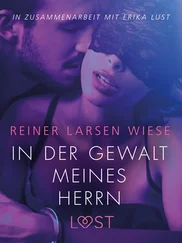Da die Wahrnehmung von Bewegungen für höher entwickelte Organismen eine lebensrelevante Bedeutung besitzt, haben sich dafür im Laufe der evolutionären Entwicklung einige relativ starre – und deshalb auch täuschungsanfällige – Wahrnehmungsmechanismen herausgebildet. Eine solche Bewegungstäuschung, die bereits von den Gestaltpsychologen vor etwa hundert Jahren untersucht wurde, besteht darin, dass zwei in Nachbarschaft kurz hintereinander aufleuchtende Lichtpunkte als ein bewegter Punkt wahrgenommen werden (»Phi-Phänomen«). Diese Täuschung entsteht auch dann, wenn nicht Lichtpunkte, sondern Bildelemente ihre Position schrittweise von einer Darstellung zu anderen verändern, was bekanntlich die Voraussetzung für die Entwicklung der Filmtechnik war: Bewegte Szenen, die mit 24 Bildern pro Sekunde fotografiert wurden, lösen bei gleichermaßen schnell aufeinanderfolgender Darbietung einen natürlichen Bewegungseindruck aus.
Bewertungsfunktionsiehe S. 252 f.
Wenn für einen Problemtyp keine sichere Lösungsstrategie verfügbar ist (»Algorithmus«), dann muss mittels → Heuristiken eine schrittweise Annäherung an Zielzustände versucht werden. Um allerdings einschätzen zu können, ob und wie stark man sich dem Ziel nähert, ist den Zuständen im Problemraum eine Bewertungsfunktion zuzuordnen (z. B. Einschätzung der Entfernung zu einem gesuchten Ziel, Chanceneinschätzung für einen Gewinn, Attraktivität einer Situation). Ein vom Prinzip her auch in der Mathematik und Statistik eingesetztes heuristisches Verfahren zur Optimierung von Zuständen ist die
»Methode der Unterschiedsreduktion«, bei der jener Pfad im Problemraum ausgewählt wird, der schrittweise mit der größten Bewertungszunahme verbunden ist.
Bewertungssystemsiehe S. 172 f.
Das Aktivierungssystem stellt nur einen groben Regulationsmechanismus zur biologischen Bewertung von Lebensumständen dar, sodass sich in der Phylogenese komplexer Lebensformen (Säugetiere) bald auch ein differenzierteres zentralnervöses Bewertungssystem, nämlich das → limbische System (→ Amygdala ), herausbildete. Dieses nimmt laufend einen Vergleich zwischen Ist- und Sollwerten im biologischen und psychischen Bereich vor und stellt fest, ob die gegebene Situation grundsätzlich eher als günstig oder als ungünstig einzuschätzen ist (Critchley & Garfinkel, 2018). Führt dieser Vergleich zu einem positiven Ergebnis, dann manifestiert sich dies subjektiv in einem positiven Gefühl (Zufriedenheit, Freude, Glück,…), verbunden mit der Tendenz, den vorhandenen Zustand aufrechtzuerhalten und die gerade ausgeübte Tätigkeit fortzusetzen oder in Zukunft zu wiederholen (z. B. Essen, wenn etwas gut schmeckt). Weichen jedoch die Istvon den Sollwerten zu stark ab, dann kommt es zu einem negativen Gefühl, wie etwa Unruhe, Angst oder Aggression, verbunden mit der Tendenz, den vorhandenen Zustand zu verändern und in Zukunft zu vermeiden. In die Bewertung der Situation fließt auch die Wahrnehmung des eigenen Aktivierungsniveaus und der körperlichen Empfindungen mit ein (Critchley & Harrison, 2013).
Bewusstseinsiehe S. 103–106
Das Bewusstsein hat innerhalb der Psyche die besondere Funktion, den Output aus verschiedenen Systemen zu integrieren, den Transfer in Langzeitspeichersysteme zu bewirken und Informationen an psychische »Filterprozessoren« (z. B. Aufmerksamkeit) oder »Servomechanismen« (z. B. Sprachzentren) als modulare Informationsverarbeitungssysteme weiterzugeben. Als eine der wichtigsten Funktionen fällt dem Bewusstsein nach Mandler (1979, 78) »die Prüfung potenzieller Handlungsmöglichkeiten und die Bewertung der situativen Gegebenheiten« zu. Nach Solso (2005, 150) scheint das Bewusstsein »der hauptsächliche Prozess zu sein, mit dessen Hilfe sich das Nervensystem an neuartige, herausfordernde und informative Ereignisse in der Welt anpasst«.
Bewusstseinslagesiehe S. 108
Mit Bewusstseinslage umschreibt man den Grad an bewusster Kontrolle psychischer Abläufe, der bei äußerster Konzentration im Wachzustand sein Maximum und im Tiefschlaf sein Minimum erreicht.
Bewusstseinszuständesiehe S. 108–116
Als Bewusstseinszustände bezeichnet man Ausprägungen des Bewusstseins wie die Bewusstseinslage, Schlaf, Traum, Hypnose, Mediation und Zustände, die durch psychoaktive Medikamente und Drogen ausglöst werden.
Beziehungsabbruchsiehe S. 358
Für das Scheitern romantischer Beziehungen (Liebesbeziehungen) führt Gottman (1998a, 1998b) vor allem vier Hauptgründe an, die zu einem Teufelskreis negativ dominierter Kommunikation führen:
•Tendenz zu Kritik (an der Person, nicht am Verhalten)
•Abwehr (z. B. von »Schuld«, Verantwortung, Einsicht, Selbsterkenntnis)
•Verachtung (z. B. Beleidigen, Beschimpfen, Spott, Sarkasmus)
•Abblocken (z. B. Schweigen, Zurückziehen, Mauern)
Der Wunsch, den anderen ändern zu wollen, führt häufig zu einem kommunikativen »Forderungs-Rückzug-Muster« (Malis & Roloff, 2006), welches häufig zur Verschlechterung in Partnerschafts- und Eltern-Kind-Beziehungen beiträgt. Um aber eine längerfristige erotische Partnerschaft erfolgreich aufrechterhalten zu können, ist nach Gottman (1998b) zumindest ein Häufigkeitsverhältnis von 5 : 1 zwischen positiven und negativen Verhaltensweisen nötig. Als Gründe für einen Beziehungsabbruch geben Frauen zu geringe Offenheit des Partners, zu wenig eigene Autonomie und einen Mangel an Aufgaben- und Verteilungsgerechtigkeit an, während Männer zu wenig »Romantik« im Zusammenleben beklagen (Baxter, 1986).
Beziehungsregelnsiehe S. 357
Argyle und Henderson (1986) gehen in einer internationalen Studie der Frage nach, welche Beziehungsregeln für soziale Relationen (z. B. Arbeits-, Nachbarschafts-, Freundschafts- und Liebesbeziehungen) als die wichtigsten erachtet werden, und bezogen dafür Befragungspersonen aus vier Ländern ein (Großbritannien, Italien, Japan, Hongkong):
•Die Intimsphäre des anderen respektieren
•Vertrauliche Mitteilungen bewahren
•Den anderen nicht öffentlich kritisieren
•Während des Gesprächs immer wieder Augenkontakt halten
Häufige Verstöße gegen diese Regeln schwächen nach Meinung der Befragten eine Beziehung oder führen zu einem Beziehungsabbruch.
Bicameral Mindsiehe S. 19
Julian Jaynes (Psychologieprofessor in Princeton) stellte aufgrund antiker Texte aus der Zeit von 3000 bis etwa 700 v. Chr. (Sumer, Babylon, Ägypten, Mayakultur,…) die Hypothese auf, dass die damaligen Menschen noch kaum über ein introspektives (sich selbst wahrnehmendes) Bewusstsein verfügt hätten, sondern nur über eine »bikamerale« Psyche. Darunter versteht Jaynes (1976/1993) eine relativ unabhängige Arbeitsweise beider Gehirnhälften, bei der die rechte Hälfte akustische oder visuelle Halluzinationen in die linke Gehirnhälfte projiziert, welche als »Stimmen« oder »Erleuchtungen« von Göttern interpretiert worden sein könnten. Jaynes bezeichnet solche halluzinierten »Götterstimmen« als neurologische Imperative, welche vielleicht erzieherische oder sittliche Anweisungen (soziale Kontrolle!) zum Ausdruck brachten.
Bindungsstilsiehe S. 420 ff.
Der Bindungsstil ist ein besonders wichtiges Vorhersagekriterium psychischer Gesundheit einer Person. Die »Bindungstheorie« von Bowlby (1969, 1973, 1980) betont die evolutionäre Bedeutung des Bindungsbedürfnisses ab der Geburt bis ins Erwachsenendasein und beschreibt die Folgen positiver und negativer Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Feinfühligkeit der primären Bezugsperson (meist Mutter). Mary Ainsworth entwickelte ein standardisiertes Beobachtungsverfahren zur Identifizierung von bestimmten Verhaltensmustern, wie Kinder im Alter von 11 bis 20 Monaten auf eine Trennung von der Mutter reagieren (Ainsworth et al., 1978). siehe → Bindungsverhalten .
Читать дальше