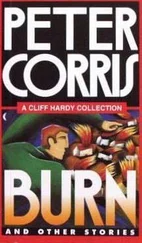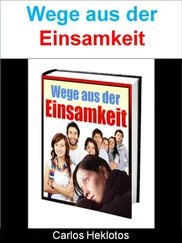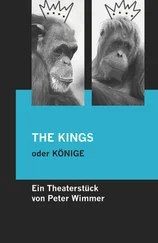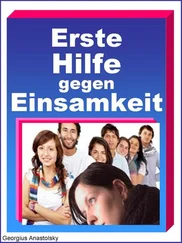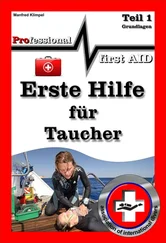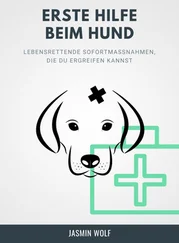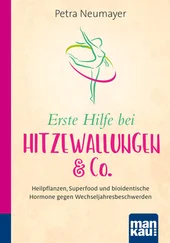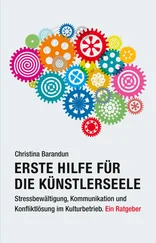Auf glattem Untergrund: auf einer Plane ziehen
Ziehen auf einer Plane
Auf glattem Untergrund (Sand, Schnee) ist diese Methode wirklich prima. Das Überrollen auf die Plane lernst du später kennen (→ 123). Wenn es schnell gehen muss, kann man einen Patienten auch an der Kleidung anfassen und wegschleppen.

Bild 10:
Unangenehm für den Patienten: Gamstragegriff
Gamstragegriff
Dieser Griff eignet sich sogar zum Transport über etwas weitere Strecken. Er ist für den Patienten allerdings besonders unangenehm.

Bild 11:
Komfortabel auf breitem Weg: Tragesitz, ggf. mit Tragering
Tragesitz mit zwei Helfern
Die Helfer geben sich die »vorderen« Hände und setzen den Patienten darauf, der seine Arme um den Hals der Helfer legt. Noch besser geht es mit einem (Dreiecktuch-)Tragering. Allerdings muss der Weg breit genug sein!

Bild 12:
Techniken zur Eigensicherung und zum Abschleppen im Rettungsschwimmkurs erlernen
Rettungsschwimmen
Jeder kann in die Situation kommen, einen Menschen aus dem Wasser retten zu müssen.
Besonders wichtig ist dabei, an die eigene Sicherheit zu denken. Wenn dich der Ertrinkende umklammert oder unter Wasser drückt, weiche nach unten aus.

Bild 13:
Im Wildwasser den Mund über Wasser halten
Bei allen Rettungstechniken muss man darauf achten, den Mund des Patienten über Wasser zu halten.
Am besten lernst du all dies in speziellen Kursen.
2.2 Umfeld und Unfallmechanismus geben Hinweise auf die Ursache der Verletzung bzw. Erkrankung
Augen auf!  Verdachtsmomente
Verdachtsmomente
Schon beim ersten Ansehen der Situation kannst du mögliche Ursachen für bestimmte Verletzungen oder Erkrankungen wahrnehmen.
Unfallmechanismus genauso bedeutsam wie körperliche Untersuchung
Wenn dein Kletterpartner beim Bouldern an einem Überhang aus zwei Meter Höhe auf den Rücken gefallen ist, musst du mit einer Wirbelsäulenverletzung rechnen. Dies gilt umso mehr, wenn du bei genauerer Analyse des Unfallmechanismus feststellst, dass die Wirbelsäule beim Sturz geknickt wurde. Wenn er zusätzlich auf den Kopf gefallen ist und sich nicht mehr an den Unfallhergang erinnert, kannst du auf eine Gehirnerschütterung schließen. All diese Schlussfolgerungen kannst du ohne detaillierte körperliche Untersuchung ziehen und dennoch sind sie für deine Diagnose genauso bedeutsam wie die Beule, die du am Hinterkopf ertasten kannst. Du siehst also: Es lohnt sich, dem Unfallmechanismus besondere Beachtung zu schenken.
Umfeld als einziger Hinweis
In manchen Fällen liefert das Umfeld sogar den einzigen Hinweis auf die Ursache: Beispielsweise wirst du bei Kopfschmerzen in 4000 Meter Meereshöhe auf eine Höhenkrankheit tippen. Treten sie jedoch am Abend eines sonnigen Tages auf und ist der Patient ohne Kopfbedeckung in der Sonne gewesen, musst du eher einen Sonnenstich vermuten.
Manchmal kannst du dich schon aus der Entfernung auf mögliche Verletzungen einstellen: Wenn jemand aus einer Lawine gerettet wird, rechnest du z. B. mit einer Atemstörung, Knochenbrüchen und ggf. einer Unterkühlung.
Diese Beispiele sagen sicherlich mehr als tausend Worte. Bei jedem Notfall gilt also: Augen auf und das Umfeld bzw. den Unfallmechanismus genau analysieren.
»Mentales Training« für den Ernstfall
Ein Weg, seine Fähigkeiten in der Beurteilung des Umfelds zu perfektionieren, besteht darin, (auch ohne Notfall) seine Umgebung auf Gefahrenpunkte hin zu untersuchen. Mithilfe dieses »mentalen Trainings« schult man seinen Blick für Gefahren und erkennt den Unfallmechanismus dann im Ernstfall oft auf einen Blick. Natürlich lohnt es sich genauso, sicherheitsrelevante Literatur zu studieren. Für Bergsteiger und Kletterer sind beispielsweise die Bücher »Sicherheit und Risiko in Eis und Fels« von Pit Schubert interessant. Eine besonders gute mentale Vorbereitung ist natürlich ein speziell auf die Outdoorsituation zugeschnittener Erste-Hilfe-Kurs, in dem realistisch nachgestellte Notfallszenarien durchgespielt werden.

Bild 14:
Klettern in den winterlichen Rocky Mountains – eine Situation, in der zahlreiche Gefahren drohen!

Info: Gefahren in großer Höhe – Höhenkrankheit & Co.
Alle 5500 Höhenmeter nimmt der Luftdruck um etwa die Hälfte ab. Damit halbiert sich jeweils auch der so genannte Partialdruck des Sauerstoffs, der für die Aufnahme des Sauerstoffs in der Lunge (Diffusion) entscheidend ist. In der Höhe entsteht folglich ein Sauerstoffmangel im Blut. Probleme ergeben sich bei den meisten Menschen frühestens ab 2500 Höhenmetern. Bis auf Höhen von 5500 Meter kann sich der Körper anpassen, wenn man ihm genügend Zeit dafür lässt (Akklimatisation). Also: Lass dir Zeit beim Aufstieg!
Wenn du eine Tour in große Höhen planst, informiere dich über Akklimatisationsstrategien und den Umgang mit höhenbedingten Problemen. Jeder kann höhenkrank werden, aber niemand muss daran sterben!Gute Quellen sind z. B. www.bexmed.de, www.himalayanrescue.orgund verschiedene Bücher.
Als gute Faustregeln gelten folgende Empfehlungen:
• Lerne Anzeichen für höhenbedingte Probleme (s. u.) erkennen und verstehen.
• Steige bei entsprechenden Anzeichen nicht weiter auf.
• Steige ab, wenn die Anzeichen schlimmer werden oder nach einem Ruhetag nicht verschwinden. Bei gravierenden Anzeichen (s. u., HACE/HAPE) sofort absteigen auf die Höhe, auf der der Patient zuvor eine Nacht symptomfrei verbacht hat. (BERGHOLD/SCHAFFERT 2008, 161)
• Achte auf andere Gruppenmitglieder. Lass einen Höhenkranken nie allein.
Höhenkrankheit – Acute Mountain Sickness (AMS)
Das Leitsymptom sind Kopfschmerzen. Des Weiteren können Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen auftreten. Man schläft schlecht und fühlt sich matt. Steigt der Ruhepuls um mehr als 20 % über den persönlichen Normwert, ist das ein schlechtes Zeichen. Wer die Anzeichen der Höhenkrankheit ignoriert, muss mit schwerer wiegenden Problemen rechnen:
Höhenlungenödem – High Altitude Pulmonary Edema (HAPE)
Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge führen zu einem plötzlichen Leistungsabfall und zu ungewöhnlicher Atemnot bei geringer Belastung. Der Patient hustet und zeigt eventuell brodelnde Atemgeräusche. Es besteht Lebensgefahr! Um die Anstrengung beim Abstieg zu minimieren, solltest du ihn ggf. transportieren (→ 159).
Читать дальше
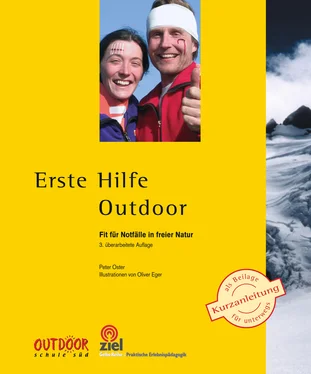




 Verdachtsmomente
Verdachtsmomente