Martin Schniertshauer und Kerstin Kunz
1.1 Kommunikationskompetenz – gestern, heute und morgen
Die Kommunikationskompetenz der einzelnen Berufsgruppen im Gesundheitswesen kann unterschiedlicher kaum sein. Schon in der ärztlichen Ausbildung ist es von erheblicher Bedeutung, an welcher Universität das Studium stattfindet und in welcher Weise die Lehre von Kommunikationskompetenz umgesetzt wird.
Auch in der rettungsdienstlichen Ausbildung hat sich das Thema Kommunikation erst mit dem seit 2014 existierenden neuen Berufsbild des Notfallsanitäters 1 1 Zugunsten einer lesefreundlichen Darstellung wird in diesem Text bei personenbezogenen Bezeichnungen in der Regel die männliche Form verwendet. Diese schließt, wo nicht anders angegeben, alle Geschlechtsformen ein (weiblich, männlich, divers).
etabliert und wird auch in Form einer mündlichen Prüfung sowie als Teil der praktischen Prüfung im Staatsexamen relevant.
Die Relevanz von Kommunikationskompetenz in Gesundheitsfachberufen hat sich die letzten Jahre stark weiterentwickelt und es ist anzunehmen, dass diese die nächsten Jahre steigen wird. Allein im Rahmen der Verbesserung der Patientensicherheit durch Optimierung der Teamkommunikation, z. B. durch die Einführung und Anwendung von Crew Resource Management (CRM) in Behandlungsteams, nimmt das Thema Kommunikation einen unverzichtbaren Stellenwert ein. Ebenso bei der Bearbeitung von Beschwerden durch Patienten und Angehörige und gleichzeitig der Verbesserung der Kundenkommunikation (gemeint sind Patienten und Angehörige) kommt ein Unternehmen mit seinen Abteilungen, wie z. B. einer Notaufnahme, nicht darum herum, sich mit Kommunikation zu beschäftigen.

 Empfehlung
Empfehlung 
Das Projekt Joint Medical Master (JMM-HSG/UZH) der Universität St. Gallen und der Universitätsmedizin Zürich greift den Ansatz der interdisziplinären Teamkommunikation auf und bildet in einem Kommunikationstraining Pflegefachkräfte und Studenten der Humanmedizin gemeinsam im Thema Kommunikation im Team und mit Patienten und Angehörigen aus. Inhalte sind neben der effektiven Teamkommunikation eben auch Angehörigenkommunikation, wie z. B. das Überbringen von Todesnachrichten. Weitere Informationen: https://med.unisg.ch/de/lehre/joint-medical-master(Zugriff am: 27.10.2020)
Solche und weitere Beispiele werden auch in Zukunft notwendig sein und die nötige, wenn auch nicht durchgehende Kommunikationskompetenz in Gesundheitsfachberufen liefern.
1.2 Notfall, Stress und Kommunikation
Stellen Sie sich folgende Situation vor:

 Fallbeispiel
Fallbeispiel 
Die Notfallpflegerin und Praxisanleiterin Anna betreut heute in der Schicht die Fachkursschülerin Marion aus einer anderen Klinik, die einen Praxiseinsatz in der Notaufnahme von Anna verbringt. Bei der Schockraumversorgung eines jungen polytraumatisierten Patienten kommt es plötzlich zu einer kritischen Blutungssituation, die das komplette, sonst sehr ruhig arbeitende Schockraumteam kurzfristig unter hohen Stress setzt.
Dabei nimmt Marion das sich deutlich veränderte Kommunikationsverhalten von Anna wahr. War sie sonst immer sehr ruhig, hat sich gewählt, höflich und sehr wertschätzend ihr gegenüber ausgedrückt, ist dies nun völlig anders. Der Tonfall ist deutlich lauter, die Ansagen sind kurz und knapp, sehr direkt, unmissverständlich und die Höflichkeit ist verschwunden.
Was passiert mit unserer Kommunikation unter Stress?
Stress bedeutet für den Einzelnen grundsätzlich eine psychische und physische Ausnahmesituation. Bei Stress verändern sich Körperfunktionen, die Wahrnehmung und Kognition sowie das Verhalten. Was früher eine sinnvolle Funktion zur Flucht darstellte, kann uns im Arbeitsalltag behindern.
Gerade die Fähigkeit zur Kommunikation sowie zur Metakommunikation (also der Kommunikation über die Kommunikation) leidet unter Stress. Sind wir ohne Stress dazu in der Lage, auf unseren Kommunikationspartner sensibel und empathisch einzugehen, die ein oder anderen Kommunikationsstörungen zu erkennen und zu vermeiden, wird dies unter Stress deutlich eingeschränkter sein.
Die Teamkommunikation unter Stress verändert sich z. B. in folgenden Punkten:
• Der Tonfall wird lauter, denn wichtige Informationen müssen im Team gehört werden.
• Die Kommunikation wird kürzer und deutlich prägnanter, eben auf das Wesentliche reduziert.
• Höflichkeiten verschwinden größtenteils.
• Begründungen und Argumentationen gibt es nur, wenn unbedingt nötig.
Diese Veränderungen sind der Situation geschuldet und haben in der Regel (auch hier gibt es natürlich Ausnahmen) nichts mit der zwischenmenschlichen Beziehung der Teammitglieder zu tun, auch wenn dies manchmal so empfunden wird. Selbstverständlich darf auch in solchen Fällen die Kommunikation nicht verletzend sein.
Gerade unerfahrene Teammitglieder können von der sich plötzlich veränderten Kommunikation schnell eingeschüchtert werden. Ein wichtiger Schritt in einer solchen Situation könnte sein, dass zu Beginn der Schockraumversorgung das Team durch den Teamleiter kurz über die veränderte Kommunikation informiert wird. Am Ende der Schockraumversorgung, wenn sich die Situation normalisiert hat, kann ein höfliches Dankeschön an das Team die Situation auch kommunikativ wieder normalisieren. Studenten, Praktikanten, Auszubildende und unerfahrene Teammitglieder profitieren ganz deutlich von einer Team-Nachbesprechung (Debriefing), bei der auch die veränderte Kommunikationssituation thematisiert wird.

 Fallbeispiel
Fallbeispiel 
Die Notfallpflegerin Anna bekommt vom leitenden Arzt die Aufgabe, die wartenden Angehörigen kurz zu informieren, dass der Patient jetzt direkt in den OP gebracht wird. Sie soll die Angehörigen in einen speziellen Warteraum begleiten, in dem sie auf das danach folgende Gespräch mit dem Arzt warten sollen. Vor dem Gespräch verlässt Anna den Schockraum, nimmt sich schnell einen Glas Wasser und atmet kurz durch. Dann schafft Sie es wie gewohnt ruhig, empathisch, wertschätzend und höflich mit den Angehörigen zu reden und begleitet diese in den Warteraum. Marion ist beeindruckt von Annas Fähigkeit, nach dieser Situation so schnell wieder auf ihr gewohntes Kommunikationsmuster umzuschalten.
Gerade wenn kurz nach einer solchen Situation mit veränderter Kommunikation im Team der Kontakt und das Gespräch mit den Angehörigen stattfindet, kann es sein, dass die veränderte Kommunikation auch in das Gespräch mit den Angehörigen übertragen wird.
Auf eine Nachfrage der besorgten Eltern »Wie geht es unserem Sohn?« kann schnell im Vorbeilaufen die kurze und prägnante Antwort »…liegt noch im Schockraum, kommt gleich in OP, mehr wissen wir noch nicht…« folgen.
Читать дальше
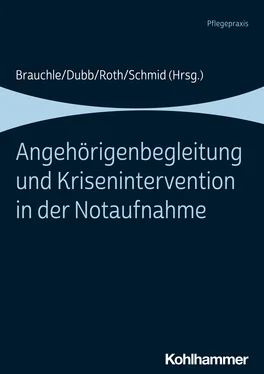

 Empfehlung
Empfehlung 
 Fallbeispiel
Fallbeispiel 










