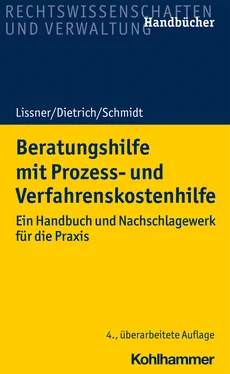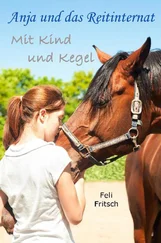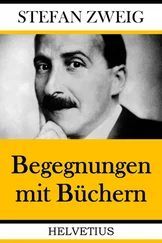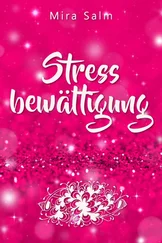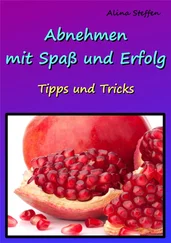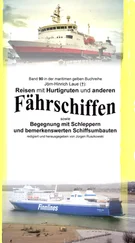§ 13 WoGV (Wohngeldverordnung)Belastung aus der Bewirtschaftung
(1) Als Belastung aus der Bewirtschaftung sind Instandhaltungskosten, Verwaltungskosten und Betriebskosten ohne die Heizkosten auszuweisen.
(2) Als Instandhaltungs- und Betriebskosten sind im Jahr 36 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und je Quadratmeter Nutzfläche der Geschäftsräume sowie die für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung entrichtete Grundsteuer anzusetzen. Als Verwaltungskosten sind die für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung an einen Dritten für die Verwaltung geleisteten Beträge anzusetzen. Über die in den Sätzen 1 und 2 genannten Beträge hinaus dürfen Bewirtschaftungskosten nicht angesetzt werden.
Aufwendungen, die dagegen zur reinen Kapitalbildungvorgenommen worden sind (z. B. die Partei bewohnt das Haus gar nicht), dienen allein der Vermögensbildung und bleiben daher unberücksichtigt. 353
Dasselbe gilt bei Ferienhäusern und ‑wohnungen. 354
64 c) Mehrere Bewohner mit eigenen Einkünften.Wenn mehrere Personen mit eigenem Einkommenin der Wohnung (im Familienverbund ‑insbesondere Kinder mit eigenem Einkommen- oder mit Dritten) leben, kann der Rechtsuchende nicht die volle Miete als Abzugsposten beanspruchen. Es stellt sich daher die Frage nach der Kostenaufteilung.
Hinweis:
Zunächst sollte nach den unter den Bewohnern miteinander getroffenen Absprachen 355gefragt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass keine rechtmissbräuchlichen Absprachen vorliegen. In diesem Zusammenhang ist die gesamte wirtschaftliche Situation aller in der Haushaltsgemeinschaft lebenden Personen auf den Prüfstand zu stellen. Eine zwischen den
Mitbewohnern getroffene, zu einer unangemessenen Belastung der Staatskasse führende Vereinbarung über die Verteilung der Mietkosten kann nicht anerkannt werden. 356
Gibt es unter den Bewohnern keine Absprachen, sind die Kosten schon aus Billigkeitsgründen nach Kopfteilen im Zusammenhang mit den jeweiligen Einkommenaufzuteilen, minderjährige Kinder werden nicht mitgerechnet. 357Minderjährige Kinder, denen nur Unterhaltszahlungen zufließen, scheiden bei der Berechnung des Mietkostenanteils aus. 358Die Einkommen sind dabei als „unbereinigte Nettoeinkommen“ zu berücksichtigen, d. h. ohne Abzüge wie z. B. Erwerbstätigenfreibetrag, Unterhaltsfreibeträge, Werbungskosten und sonstige besondere Belastungen. 359Die Gegenansicht 360bereinigt die Nettoeinkommen zunächst um die Abzüge gem. § 115 Abs. 1 ZPO mit Ausnahme der Wohnkosten.
Haben die Ehegatten ungefähr gleiches Einkommen, ist eine hälftige Aufteilungvertretbar. 361Differieren die Einkommen erheblich, kann eine Aufteilung im Verhältniserfolgen. 362Ist das Einkommen des anderen Ehegatten so niedrig, dass die Gewährung der Unterkunft durch den anderen Ehegatten als Unterhalt anzusehen ist, dann ist es unberücksichtigt zu lassen; 363dies gilt auch, wenn dessen Einkommen nicht einmal den allgemeinen Freibetrag gem. § 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 2a ZPO erreicht. 364
Ggfs. können die anderen Einkommenshöhen auch geschätzt werden.
Möglich ist aber auch eine Aufteilung nach dem Verhältnis der genutzten Flächen.Gerade bei studentischen Wohngemeinschaftenist eine Aufteilung der zu zahlenden Miete nach Wohnfläche (z. B. Student A bewohnt ein Zimmer von 25 m² Größe, Student B ein Zimmer von 35 m² Größe; entsprechend zahlt Student B auch einen höheren Mietanteil als Student A) oftmals üblich.
Bei familiären Gemeinschaftenlassen sich dagegen die einzeln genutzten Flächen in der Regel nicht abgrenzen. Auch sind gemeinsam genutzte Räume schwierig zu bewerten.
5.Mehrbedarfe (Abzüge gem. § 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 ZPO)
65Gemäß § 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 ZPO sind Mehrbedarfe gem. §§ 21 SGB II, 30 SGB XIIabziehbar. Der Rechtsuchende muss sich dabei nicht auf diesen berufen. 365Der Zweck dieser Regelung liegt darin, dass die hier genannten Personen, die sich in besonderen Lebenssituationen befinden, ihren notwendigen Lebensunterhalt decken können.
Erhält der Rechtsuchende die Leistungen als staatliche Hilfe, so sind diese zunächst als Einkommen zu berücksichtigen und sodann pauschal gem. § 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 ZPO abzuziehen. Die konkrete Darlegungspflicht entfällt hierbei. Ergeben sich daher in diesen Fällen schon allein aus den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechende Anhaltspunkte, so ist ein entsprechender Abzug vorzunehmen.
Bestreitet hingegen der Rechtsuchende seinen Lebensunterhalt aus eigenen Einkünften, so kann ein entsprechender Mehrbedarf ebenfalls in Abzug gebracht werden. In diesem Fall sind jedoch die sozialhilferechtlichen Tatbestandsvoraussetzungenfür den geltend gemachten Mehrbedarf konkret darzulegen und glaubhaft zu machen, das reine Vorliegen eines Mehrbedarfs genügt hier insoweit nicht (dieser wäre dann ggfs. eine besondere Belastung nach § 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 ZPO). 366
§ 21 SGB II
(1) 66Mehrbedarfe umfassen Bedarfe nach den Absätzen 2 bis 7, die nicht durch den Regelbedarf abgedeckt sind.
(2) Bei werdenden Müttern wird nach der zwölften Schwangerschaftswoche bis zum Ende des Monats, in welchen die Entbindung fällt, ein Mehrbedarf von 17 Prozent des nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs anerkannt.
(3) Bei Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen, ist ein Mehrbedarf anzuerkennen
1. in Höhe von 36 Prozent des nach § 20 Absatz 2 maßgebenden Bedarfs, wenn sie mit einem Kind unter sieben Jahren oder mit zwei oder drei Kindern unter 16 Jahren zusammenleben, oder
2. in Höhe von 12 Prozent des nach § 20 Absatz 2 maßgebenden Bedarfs für jedes Kind, wenn sich dadurch ein höherer Prozentsatz als nach der Nummer 1 ergibt, höchstens jedoch in Höhe von 60 Prozent des nach § 20 Absatz 2 maßgebenden Regelbedarfs.
(4) Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Behinderungen, denen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 des Neunten Buches mit Ausnahme der Leistungen nach § 49 Absatz 3 Nummer 2 und 5 des Neunten Buches sowie sonstige Hilfen zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben oder Eingliederungshilfen nach § 112 des Neunten Buches erbracht werden, wird ein Mehrbedarf von 35 Prozent des nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs anerkannt. Satz 1 kann auch nach Beendigung der dort genannten Maßnahmen während einer angemessenen Übergangszeit, vor allem einer Einarbeitungszeit, angewendet werden.
(5) Bei Leistungsberechtigten, die aus medizinischen Gründen einer kostenaufwändigen Ernährung bedürfen, wird ein Mehrbedarf in angemessener Höhe anerkannt.
(6) Bei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit im Einzelfall ein unabweisbarer, besonderer Bedarf besteht; bei einmaligen Bedarfen ist weitere Voraussetzung, dass ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 ausnahmsweise nicht zumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht möglich ist. Der Mehrbedarf ist unabweisbar, wenn er insbesondere nicht durch die Zuwendungen Dritter sowie unter Berücksichtigung von Einsparmöglichkeiten der Leistungsberechtigten gedeckt ist und seiner Höhe nach erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf abweicht.
(6a) Soweit eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund der jeweiligen schulrechtlichen Bestimmungen oder schulischen Vorgaben Aufwendungen zur Anschaffung oder Ausleihe von Schulbüchern oder gleichstehenden Arbeitsheften hat, sind sie als Mehrbedarf anzuerkennen.
(7) Bei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit Warmwasser durch in der Unterkunft installierte Vorrichtungen erzeugt wird (dezentrale Warmwassererzeugung) und deshalb keine Bedarfe für zentral bereitgestelltes Warmwasser nach § 22 anerkannt werden. Der Mehrbedarf beträgt für jede im Haushalt lebende leistungsberechtigte Person jeweils
Читать дальше