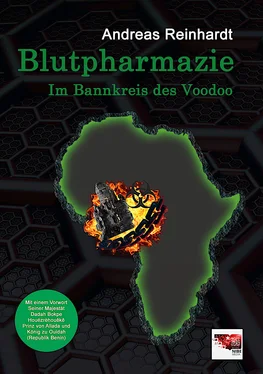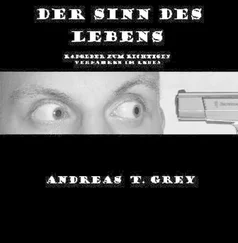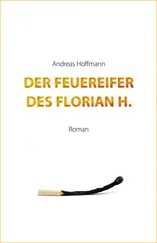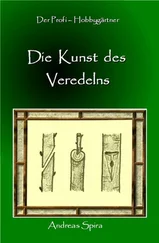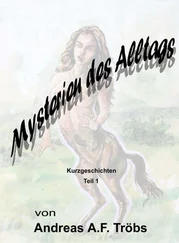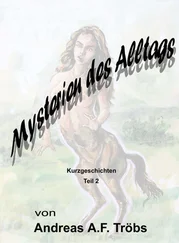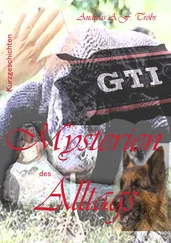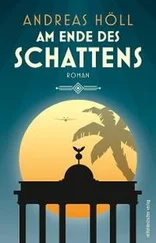Wieder folgte die Erklärung ohne Zögern: »Um es mit den Worten eines deutschen Historikers zu sagen: 'Es geht um Gerechtigkeit, es geht um die Einübung von Respekt. Ein humanes Verhalten gegenüber Mitmenschen schließt auch ein humanes Verhalten gegenüber den Toten, gegenüber unserer Vergangenheit ein'. – Meine Mutter war Kongolesin, aber mein Vater war Deutscher. Ich bin es mir und meinen Ahnen schuldig. Preußen und das Deutsche Kaiserreich waren weit ab von gesellschaftlicher und politischer Perfektion, keine Frage. Aber man muss diese beiden Staaten in ihrer Gesamtheit und mit gebührendem Respekt betrachten, so wie man es auch anderen Nationen und deren Geschichte zugesteht. Das ist meine feste Überzeugung.«
»Die Bürde des Verlierers zweier Weltkriege. Die Wahrheit wird vom Sieger diktiert«, kommentierte der Zuhörer nicht ohne Mitleid.
Kompromissloser Ernst ersetzte endgültig die Leichtigkeit: »Interessiert mich nicht, ich ziehe Tatsachen vor. Wie hast du so treffend gesagt, die Wahrheit wird schließlich vom Sieger diktiert. Es reicht schon ein kompetent wirkender Erzähler, der nicht den Fehler begeht, zu sehr ins Detail zu gehen. Dann muss nur noch an einen anerzogenen Schuldkomplex appelliert werden. Unter solchen Umständen überlässt der Mensch das Denken schnell anderen. Stimmungsmache und Meinungsdoktrin aus der Feder von Vormündern im Deutschland des 21. Jahrhunderts, nicht etwa Ende des 18. Jahrhunderts in Preußen.«
»Siehst du, deshalb liebe ich es hier in den Bergen, fernab von Propaganda und einer beliebigen Welt der Verschwendung. Hier hat alles noch einen Sinn. Die Nachbarn werden mit Respekt behandelt, es gibt keine geistlose Hektik, und man lebt von und mit der Natur.«
Bonifacius hatte seinen entspannten Gesichtsausdruck derweil zurückgewonnen: »Meiner Meinung nach können wir die Herausforderungen der Zukunft nicht dadurch meistern, dass wir eine globalisierte Industrie- und Informationsgesellschaft verteufeln oder vor ihr zurückschrecken. Aber die Menschen müssen lernen, sie ernsthaft zum Wohle aller und in besserem Einklang mit der Natur zu nutzen. Denn ohne Vernunft und Weisheit richtet es uns seelisch und körperlich zugrunde.«
»Na genau aus dem Grund machst du dich morgen als investigativer Journalist auf den Weg in die Welt, richtig?«, gab Pablo in rhetorischer Manier zurück, während er vom Tisch aufstand und noch einige Oliven als Wegzehrung an sich nahm.
Sein Augenzwinkern signalisierte ein Hintergrundwissen, dass er nicht im Entferntesten besaß. Er wusste nicht, dass Bonifacius in geheimer Mission ins Voodoo-Land Benin fliegen würde, um die Hintergründe einer geheimnisvollen Seuche zu untersuchen, die jüngst im Norden des Landes ausgebrochen war. Auch wusste er nicht, dass sein Freund es im Auftrag einer Geheimgesellschaft namens „Wächter der Schöpfung“ tun würde. Primär ging es nicht darum zu recherchieren, zu befragen und die erhaltenen Informationen in erhellenden Artikeln aufzubereiten. Die Umstände rund um diese humanitäre Katastrophe waren sehr viel komplexer als offiziell verlautet. Womöglich war das Szenario gezielt herbeigeführt worden. Also würde der Mann, welcher Pablo gerade so vertraut gegenübersaß, dessen Codename „Shango“ lautete, die Hintergründe aufdecken, alle Verantwortlichen entlarven und sie ihrer gerechten Strafe zuführen. So lautete die Mission. Dies war das Credo der „Wächter der Schöpfung“.
Kapitel 4
Verdächtige Seuche in Benin
- Wächter der Schöpfung -
Der Konstantin Verlag hatte seinen Hauptsitz am Rande Berlins, in einem mehrstöckigen Gebäude, das der Fassade nach eine spätmittelalterliche Burg hätte sein können. Tatsächlich aber war die Anmutung einem prägenden Baustil der wilhelminischen Zeit geschuldet – dem romantischen Historismus, sandsteingewordene Verehrung eines vermeintlich helden- und tugendreichen Zeitalters. Ursprünglich das Zuhause der öffentlichen Verwaltung in Deutschem Kaiserreich, Weimarer Republik und Drittem Reich, ging das imposante Bauwerk schließlich in das Eigentum des unabhängigen Konstantin Verlages über. Wie zuvor auch, war ein romantischer Anspruch vor allem auf die Fassade beschränkt. Im öffentlichen Tagesgeschäft erschloss sich das am ehesten im faktenbasierten investigativen Arbeiten der Journalisten für die verschiedenen Redaktionen im Hause sowie in der allgemeinen Immunisierung gegen äußere Einflussnahme. Das damit verknüpfte inoffizielle Tätigkeitsfeld hingegen spielte sich entsprechend der Aktivitäten in geheimen Stockwerken unterhalb des Verlagshauses ab. Dort hatte die Geheimgesellschaft der „Wächter der Schöpfung“ ihren Mittelpunkt.
Bonifacius Kidjo wusste um seine tragende Rolle als Speerspitze dieser unsichtbaren Organisation, besonders auf dem afrikanischen Kontinent. Er wusste um deren Entstehungsgeschichte, kannte die Vita jedes der acht Gründungsmitglieder bis ins Detail. Hier unten, verborgen vor den allzu wissbegierigen Blicken destruktiver Machtmenschen in den Reihen einer weltweit agierenden Gegnerschaft, war er zum Außenagenten ausgebildet worden und wurde er auf seine Missionen eingestimmt. Gegründet 1904 in der Reichshauptstadt Berlin unter dem Eindruck des grausam niedergeschlagenen Aufstandes der Herero und anderer angestammter Völker in Deutsch-Südwestafrika sowie einer entfesselten Kolonialherrschaft europäischer Mächte insgesamt, hatten sich damals die Liebe zum eigenen Vaterland und die tiefe Demut vor den Geboten weltumspannender Humanität gegenseitig bedingt. Daraus war in der Folge ein internationales Netzwerk entstanden, geweiht dem Kampf zum Wohle der Menschheit, zum Schutz der Schöpfung.
Sich diesem Wissen hingebend, blieb Bonifacius auf dem Hauptgang vor einem großen Ölgemälde aus dem Jahr 1907 stehen. Detailgenau war die verschworene Gemeinschaft um den Verleger Armin Konstantin dargestellt – links und rechts neben einem brennenden Kamin im Sitzungszimmer des damaligen Konstantin Verlages stehend. Blicke und Körperhaltung entsprachen dem entschlossenen Wirken zu Lebzeiten. Es war dieses leidenschaftliche Engagement, wie es vor dem Hintergrund noch immer herrschender und stetig zunehmender Unvernunft und Gier globaler Protagonisten unverändert vonnöten war. Kaum zu glauben, machte sich „Shango“ schmerzhaft bewusst, dass selbstzerstörerische Zustände, wie sie vor über einhundert Jahren geherrscht hatten, auch heute noch im Trend lagen. Konventionelles Wettrüsten für die Vorherrschaft auf den Weltmeeren oder die menschenverachtende Entwicklung von Giftgas damals, ungehemmte nukleare, chemische und biologische nebst konventioneller Aufrüstung gegenwärtig. Aber andererseits war es ja auch nie aus der Mode gekommen, ferne Völker und Länder in Geiselhaft zu nehmen, um eine moderne Interpretation der Sklaverei und Ausbeutung zu praktizieren. Im Zeitalter von Hochindustrialisierung, Digitalisierung, technischer Perfektionierung und ökologischer Luftschlösser lagen die Erfordernisse und Begehrlichkeiten klar auf der Hand. Wie ein Rauschgiftsüchtiger lechzte das Irrenhaus des Konsums nach immer mehr „Stoff“ in Form von Rohstoffen.
Was den medizinischen Fortschritt und insbesondere die Entwicklung neuer Medikamente für eine maximal leistungsfähige Bevölkerung in hochindustrialisierten Volkswirtschaften betraf, so stand die anhaltende Ausbeutung von Menschen auf einem ganz eigenen Blatt. Wo Bestimmungen und Gesetze selbst Tierversuche empfindlich einschränkten, musste man eben andernorts aktiv werden, gerne in fernen Ländern, die einstmals Kolonialgebiete gewesen waren – ohne ausreichende Kontrollinstanzen, mit willfährigen beziehungsweise korrupten Regierungen und Persönlichkeiten, empfänglich für Geldzuwendungen. Bei Bedarf stand dort selbst Menschenversuchen nichts im Weg.
Bonifacius sah sich jeden der acht Persönlichkeiten auf dem Gemälde eingehender an. Zeitlebens hatten diese sich als Produkt und Nutznießer des preußischen Erbes betrachtet. Die hervorragende Bildung verdankten sie schließlich einem beispiellosen Bildungssystem, das mit Einführung der allgemeinen Unterrichtspflicht im Jahr 1717 seinen Anfang genommen hatte.
Читать дальше