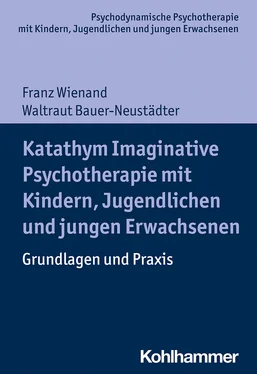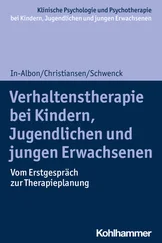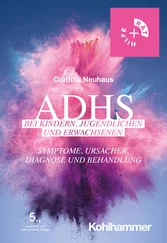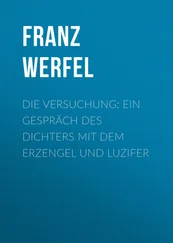Der Begriff Vorstellungskraft verweist auf die Verbindung von mentalen Vorstellungen mit körperlichen Vorgängen, die in der KIP in beide Richtungen genutzt wird: Imaginationen beeinflussen physische und physiologische Prozesse wie Entspannung und Erregung, was etwa Sportler im mentalen Training nutzen, und sie werden andererseits durch die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die Körperwahrnehmung (Muskeltonus, Atmung, Herzschlag) gefördert, vertieft und gelenkt.
Mit der Anregung, sich etwas vorzustellen, wird im Patienten ein spielerischer, kreativer, gleichsam poetischer Prozess (von gr. ποίησις (poiesis), »das Handeln, Machen, das Verfertigen, das Dichten«, nach Liddell, H.G., Scott R., Jones, H.S., 1940) in Gang gesetzt, begleitet von einer Wendung nach innen und der Aktivierung der Vorstellungskraft oder Phantasie. Phantasie [von gr. φαίνειν (phainein) »sichtbar machen, in Erscheinung treten lassen«, (n. Liddell et al., 1940) ist laut Duden die »Fähigkeit, Gedächtnisinhalte zu neuen Vorstellungen zu verknüpfen«. Diese Definition verweist auf die neurobiologische Basis der Vorstellungskraft: Schon ohne therapeutische Einflussnahme ist »unser Gehirn […] unablässig neuronal aktiv und baut dabei geistige Inhalte auf, die im Zustand der Abschirmung äußerer Reize und einer damit einhergehenden Innenorientierung zu sensorischen Wahrnehmungen führen. […] Unter Bedingungen regressiverer Art reichert sich das innere Erleben um weitere Qualitäten an« (Ullmann, 2012a, S. 21).
In einem durch Entspannung und positive therapeutische Beziehung induzierten leichten Trancezustand wird der Zugang zu unbewussten Inhalten und primärprozesshaften Vorgängen erleichtert. Die bewusste Kontrolle lässt nach, der Patient überlässt sich seinen aufsteigenden inneren Bildern. Die Aufmerksamkeit des Protagonisten verschiebt sich mehr oder weniger vom Wachbewusstsein (Sekundärprozess) zum Primärprozess, wodurch die zugehörigen Prozesse wie Verschiebung, Verdichtung, assoziatives Verknüpfen und Symbolisierung aktiviert werden.
Im Ineinandergreifen von Sekundär- und Primärprozess werden die bildhaften Vorstellungen des Probanden sowohl von seiner aktuellen psychischen und körperlichen Verfassung als auch von den durch die therapeutische Beziehung, die Motivvorgabe und die Begleitung durch den Therapeuten aktivierten Inhalten des deklarativen episodischen Gedächtnisses beeinflusst.
Die KIP verbindet Material des Primärprozesses mit Repräsentationen von Inhalten im Sekundärprozess und eröffnet so einen Raum für den kreativen Umgang mit beidem (Uhrová, 2015, S. 271).
Hanscarl Leuner bezeichnete die Entfaltung von Kreativität und kreative Problemlösung als die dritte Dimension des Katathymen Bilderlebens (neben der Bearbeitung unbewussten Konfliktmaterials und der Befriedigung archaischer Bedürfnisse) und stellte fest: »Die Fähigkeit des Menschen zu imaginieren impliziert die Eigenschaft kreativer Produktion« (Leuner, 1985, S. 282). Damit findet er sich im Einklang mit D. W. Winnicott (2012, S. 78ff.), für den Kreativität zum »Lebendigsein« und »zur Grundeinstellung des Individuums gegenüber der äußeren Realität« gehört. Kreativität in diesem allgemeinen Sinne hat eine enge Beziehung zum Spiel des Kindes. Der Spielbereich stellt einen intermediären Raum dar zwischen innerer Realität und der äußeren Welt. In der KIP »spielt« der Patient im Medium der Imagination mit Fragmenten, die seinem episodischen Gedächtnis, seinen Ängsten, Wünschen und Bedürfnissen, seinen Motiven und Konflikten und nicht zuletzt seiner Übertragungsbeziehung entstammen.
Der kreative Prozess der KIP erfolgt (nach Leuner, 1985, S. 285ff.) in verschiedenen Ebenen oder Phasen, die sich nur unscharf voneinander trennen lassen:
• Die erste Ebene ist die der passgenauen Umsetzung eines (mehr oder weniger unbewussten) Gefühls oder Konflikts in eine symbolische Darstellung: So imaginiert ein Jugendlicher vor dem Abitur zum Motiv Waldrand einen mit Gold gepflasterten Weg, der an einem dunklen, abweisenden Wald endet und ins Unbekannte abbiegt. Der goldene Weg einer behüteten Kindheit endet jäh, die Zukunft ist ungewiss und beunruhigend.
• Als zweite Ebene nennt Leuner die »Sekundärverarbeitung mit Anreicherung dieses imaginativen Materials durch Einfälle, Erinnerungen und begleitende Gefühlselemente usw.«, die in der Ausdifferenzierung des Bildes, im Nachgespräch, beim Malen oder Gestalten und bei der Nachbesprechung, dem medialen Dialog erfolgt.
• Die dritte Phase, die Inkubation, besteht in einem Zustand der Ratlosigkeit (durchaus auch des Therapeuten), der inneren Unruhe und Anspannung, der bis zur nächsten Sitzung dauern kann, oft aber auch nur als kurze Episode des Zögerns in einer Imagination auftritt. Dann ist der Therapeut zu Zurückhaltung und allenfalls fragenden Interventionen aufgefordert, um die Findung der Problemlösung durch den Patienten selbst nicht zu verhindern. Die Inkubation bereitet in der Regel eine Einsicht vor und eröffnet neue Möglichkeiten, die Dinge zu sehen und damit umzugehen.
• Als vierte Phase bezeichnet Leuner die Verifikation, die im Auftauchen von gefundenen Problemlösungen, neuen Handlungsansätzen und Wandlungen im Charakter der Imaginationen und der Symbole besteht.
Winnicott (2012, S. 78ff.) weist darauf hin, dass Kreativität zwar eine universale Eigenschaft des Menschen ist, dass zu ihrer Entfaltung aber eine einfühlsame, haltende und förderliche Umgebung von der frühen Kindheit an (und entsprechend in der therapeutischen Situation) erforderlich ist.
3.4 Symbol und Symbolisierung
Vorstellungen und Imaginationen gibt es grundsätzlich in beiden Systemen, dem Sekundärprozess und dem Primärprozess. »Eine Imagination ist dann ein (re-präsentatives, ein wieder vor Augen stellendes) Symbol, wenn sie ein Produkt des PP ist, das heißt emotionale Bedeutung hat, wenn sie nicht für sich steht, sondern für etwas anderes und dieses andere eine geistig-emotionale Erfahrung ist« (Salvisberg, 2012, S. 54):
So lässt sich der mit goldenen Pflastersteinen belegte Weg in dem oben genannten Beispiel als Symbol für eine behütete und reiche Kindheit verstehen, während der dunkle Wald, an dessen Rand er jäh endet, auf Ungewissheit und Zukunftsängste verweisen mag.
Katathyme Imaginationen repräsentieren die vergangene, erinnerte, gegenwärtige und künftig erwartete Realität auf einem symbolischen Niveau unterschiedlicher Komplexität. Symbole unterscheiden sich von Zeichen: Ein Zeichen steht in direktem Verhältnis zu dem Bezeichneten und erschöpft sich in diesem auch. Ein Symbol verweist hingegen auf ein komplexes Bedeutungsfeld, das sich im Prinzip nicht vollständig erklären oder beschreiben lässt. Symbole verbinden und vereinen Gegensätze und sind daher grundsätzlich mehrdeutig. Das Symbol stellt eine Repräsentation dar: Es verweist auf etwas anderes, das nicht angezeigt wird, sondern abwesend ist, aber im Symbol wieder vorgestellt, also (re-)präsentiert wird (Balzer, 2006). In psychoanalytischer Sicht überwinden Symbole die Trennung (wie das Kuscheltier des Kindes die abwesende Mutter repräsentiert und dadurch trösten kann), die andererseits Voraussetzung und Anreiz zur Symbolbildung ist (das real Vorhandene braucht nicht symbolisiert zu werden). Symbole wie etwa die Sprache oder Bilder bilden das Material jeder Kultur.
Die im Entwicklungsverlauf auftauchende »Fähigkeit zur Symbolbildung und -verwendung macht das Kind unabhängig von der realen Erfahrung und dem Vorhandensein der Objekte. Damit wird Denken möglich, sich etwas vorstellen, Trost, Hoffnung, sich vorerst etwas versagen – Grundlagen für Motivation, Kommunikation, Identitäts- und Autonomieentwicklung, Gewissensbildung, Triebverzicht, Frustrationstoleranz, Arbeits- und Beziehungsfähigkeit, Gestaltungskraft und damit für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung« (Wienand, 2016, S. 29).
Читать дальше