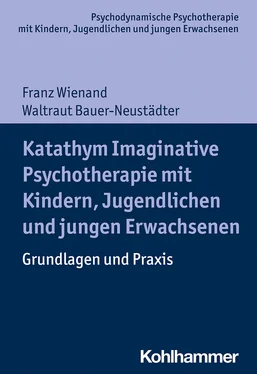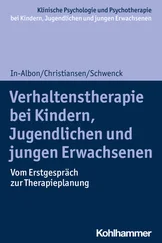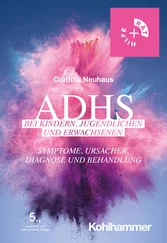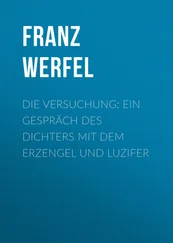Im letzten Teil des Buches erfahren Sie, wie katathyme Imaginationen in der Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeuten, speziell Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten eingesetzt werden. Die Kombination von Wissensvermittlung, Üben und Selbsterfahrung schult den Therapeuten in einem fortlaufenden Prozess. Sich flexibel in unterschiedliche Lebens- und Entwicklungsalter und dem damit verbundenen Erleben einfühlen zu können und das therapeutische Handeln darauf abzustimmen, ist für den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten unerlässlich und eine immer wieder spannende Erfahrung. Selbsterfahrung und Supervision unter Einbeziehung katathym imaginativer Techniken sind erlebnisintensiv, machen Freude, erweitern das methodenspezifische Handlungsrepertoire und stärken die Identität als KIP-Therapeut.
Calw-Saarbrücken, im November 2020
Franz Wienand und Waltraut Bauer-Neustädter
Teil I Einführung in die Katathym Imaginative Psychotherapie
1 Von den experimentellen Anfängen zur Katathym Imaginativen Psychotherapie (KIP)
Hanscarl Leuner, der 2019 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, veröffentlichte in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts als junger Arzt erste Arbeiten zum Experimentellen Katathymen Bilderleben (Leuner, 1954; 1955) und begründete damit die heutige Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP). Im Kommentar zu den Psychotherapie-Richtlinien (Faber & Haarstrick, 2018) wird die KIP unter ihrer früheren Bezeichnung KB (Katathymes Bilderleben nach Leuner) als spezielle Methode der Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie aufgeführt.
Schon früh galt Leuners besonderes Interesse der »Macht der Symbole« sowie der Symbolinterpretation. Er selbst hatte sich während seiner Weiterbildung einer Jung’schen Analyse unterzogen und so die Methode der Aktiven Imagination kennengelernt. Fasziniert von der Bildproduktion und dem Bilderleben wollte er als Arzt und Psychotherapeut das Geschehen bei seinen Patienten gerne unmittelbar mitverfolgen. Er wollte bei der Entstehung des Bilderlebens dabei sein und entwickelte so das Modell der begleiteten Imagination und des dialogischen Prinzips. Als Wissenschaftler lag es ihm am Herzen nachzuweisen, dass die Methode zu wiederholbaren Ergebnissen führt: Ein standardisierter experimenteller Traum diente dazu, das katathyme Panorama seiner Probanden zu beobachten und zu erforschen. So wurde ein methodisch-didaktisches System zur Vermittlung erarbeitet, dessen Grundzüge noch heute Gültigkeit haben.
Außerdem sollten die in der Psychotherapie verwendeten hypothetischen Symbolinterpretationen über empirische Studien genauer erfasst und damit wissenschaftlich untersucht werden. Leuner griff dabei auf Erfahrungen verschiedener Autoren zurück (Bildstreifendenken bei Kretschmer, 1922; kathartische Bilder bei Tuczek, 1928; Bilder in Tiefenentspannung bei Frederking,1948), die alle feststellten, »daß im abgeblendeten Bewusstsein des Hypnoids (oder des autogenen Trainings) optische Phänomene von Wahrnehmungscharakter auftreten, die wie die Traumbilder katathymen Ausdruckscharakter tragen« (Leuner, 1954, S. 201). »Katathym «, der Seele gemäß, weist darauf hin, dass diese Bilder oder Bildproduktionen Ausdruck eines innerseelischen Geschehens sind und dass sie individuelle Aspekte des Erlebens und/oder der inneren Verfassung abbilden. »Die sich […] im leichten Hypnoid konstellierenden Bilder spiegeln in ihrem Ausdrucksgehalt die jeweilige individuelle affektive Konstellation gerade in jenem Bereich des Unbewußten wider, das durch die Bildprovokation in relativ spezifischer Weise angeregt wurde.« (Leuner, 1954, S. 201). »Seele, d. h. Emotionalität« so die Kurzformel (Leuner, 1980).
Bei der Untersuchung des in wiederholten Sitzungen experimentell erzeugten Bildmaterials kristallisierten sich von Anfang an zwei Typen/Kategorien von Bildern heraus: Diejenigen, die sich leicht entfalteten und sich spontan oder durch suggestiven Einfluss in der dialogischen Begleitung leicht veränderten und weiterentwickelten und diejenigen, die sich als starr und festgefahren erwiesen und als fixierte Bilder bezeichnet wurden. Für Leuner waren unter diagnostischen Gesichtspunkten insbesondere letztere von Interesse, da er sie als Ausdruck »besonders fest verhafteter Affektkonstellationen – der individuellen Komplexe« (Leuner, 1954, S. 202) verstand.
Der Entwicklung des Experimentellen katathymen Bilderlebens (EKB) als klinischem Verfahren lag folgendes Konstrukt zugrunde:
• Wenn nun mit Hilfe der Bildprovokation affektive Bereiche der Persönlichkeit zur Symboldarstellung veranlasst werden konnten, dann war auch zu erwarten, dass bei typischen Motivvorstellungen immer wieder die gleichen affektiven Sphären angesprochen werden. So erweist sich die Wiese z. B. als symbolischer Ausdruck der eigenen Gestimmtheit, aber auch des Bodens, auf dem man steht. Der Bach, das fließende Wasser, wird verstanden als symbolischer Ausdruck der Entwicklungsdynamik und des Lebensflusses.
• In einem weiteren Schritt wurde davon ausgegangen, dass diese wiederholbaren Symboldarstellungen durch psychische Einwirkung, insbesondere in Folge therapeutischer Interventionen, veränderbar sind. Die Analyse eines Symbols, d. h. dessen Dechiffrierung, stellt einen folgerichtigen therapeutischen Eingriff dar, der zur Veränderung bzw. Wandlung des Symbols führt.
In einer ersten Auswertung seiner Ergebnisse konstatiert Leuner (1955, S. 246), dass »die Längsschnittbeobachtung der Psychotherapie im Bilderleben […] bei richtigem Vorgehen einen prozeßhaften Verlauf erkennen« lässt, in dem den auftauchenden Symbolen eine replizierbare, tiefenpsychologisch verstehbare Bedeutung zugeschrieben werden kann.
Nach Leuners 20 Jahre währender Entwicklungsarbeit wurde aus der klinisch-experimentellen Arbeit mit Imaginationen das damals noch »Katathymes Bilderleben« oder Symboldrama genannte Verfahren entwickelt, welches sich in der Idee, symbolische Inhalte der Imaginationen als Ausdruck individueller Problematiken zu verstehen, der Psychoanalyse verpflichtet fühlt. Antriebsgeschehen, Abwehrvorgänge, neurotische Fehlhaltungen, Übertragungs-Gegenübertragungs-Geschehen werden beachtet. Leuner selbst ordnete das Verfahren zwischen pragmatisch-hypnoiden Methoden und der Psychoanalyse ein, da es einerseits primärprozesshafte Prozesse aktiviere, es andererseits aber unbewusste Prozesse nicht immer bewusst aufdeckend benutze. Hinzu kommt die Möglichkeit, in der KIP gezielt auf Konflikte zu fokussieren. Hier spielen u. a. die »fixierten Bilder«, die sich als starre, relativ unbeeinflussbare Stereotype zeigen und als Äquivalent der neurotischen Abwehr- und Charakterhaltungen verstanden werden, eine wichtige Rolle. Für den therapeutischen Prozess und den Nachweis einer (Aus-)Wirkung entscheidend sind die Wandlungsphänomene. Dies kann durch wiederholte Übung, die unmittelbare Interpretation und Deutung einer Szene oder den Vollzug von Leistungen (Wirksamkeitserfahrung), z. B. den Aufstieg auf einen Berg, die Überquerung eines Flusses usw. passieren: Details des zuvor stereotypen Bildes verändern sich. Wandlungsphänomene treten aber auch als »synchrone Wandlung« im Verlauf des therapeutischen Prozesses auf. Bilder, Landschaften verändern sich, ohne dass sie als solche gezielt angesprochen worden wären. Letztlich wurde auch die »Operation am Symbol« schon früh als wichtiges therapeutisches Instrument erkannt. Aus dieser Arbeit entwickelten sich auch die diagnostischen und therapeutischen Instrumente. Dazu gehörten zunächst zehn Standardmotive (später erweitert auf zwölf Motive), die als wichtige Kristallisationspunkte typischer, konfliktbesetzter Bereiche dienen. Im technischen Bereich unterschied Leuner zudem drei übergeordnete Prinzipien – das übende Vorgehen, das assoziative Vorgehen und das regieführende Symboldrama – und entwickelte eine ganze Reihe von Interventionstechniken. Es zeichnete sich inzwischen ab, dass differentielle Indikationen in Abhängigkeit von der Problematik für das Vorgehen notwendig sind. So erwies sich z. B. der nicht interpretierende Ansatz bei chronisch verfestigten Problematiken als nicht ausreichend, die Notwendigkeit des Durcharbeitens musste anerkannt werden.
Читать дальше