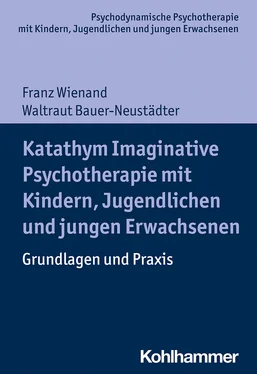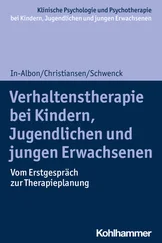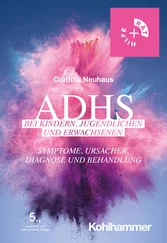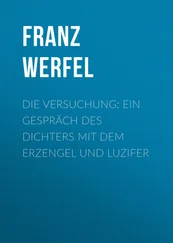• die psychophysiologische Entspannung, die mit der Intensität der erlebten inneren Bilder intensiver wird;
• »das Miterleben und Mitspielen bei einem als enorm verbindlich erlebten und selbst erschaffenen inneren Schauspiel«, das märchenhaften Charakter annehmen und Lösungen und neue Wege aufzeigen kann;
• die Begegnung mit dem individuellen und kollektiven Symbol, »mit einer vielfach determinierten Schöpfung des eigenen kreativen Unbewussten«, die bisher unzugängliches Wissen verfügbar werden lässt, sodass die Heilkraft der symbolischen Darstellung sich entfalten kann (Jung, 1949);
• die auch beim Umgang mit Imaginationen hilfreich erlebte Beziehung zu einem Therapeuten, die das symbolisch Erlebte durch die Einbettung in eine bedeutsame Objektbeziehung (Übertragungs-Gegenübertragungs-Konstellation) »wirklich« werden lässt;
• die »Anregung und Einübung neuer Erfahrungen vor dem Hintergrund eines neuen Musters von Beziehung« wie z. B. von Fürstenau (1990) für die Behandlung schwerer Persönlichkeitsstörungen beschrieben.
Einen besonderen Stellenwert schreibt Dieter dem Prinzip der Nachträglichkeit zu. Was ist damit gemeint? »Unter dem Einfluss von Übertragung und Gegenübertragung wird Vergangenes in der Gegenwart neu ›inszeniert‹. Früher erlebte konflikthafte und traumatische Erfahrungen können mit Hilfe von Imaginationen im ›Hier und Jetzt‹ zu einem besseren Ausgang geführt werden« (Dieter, 2015, S. 62). In der KIP mit Kindern und Jugendlichen kommt nicht der heute Erwachsene auf der imaginativen Ebene dem Kind zu Hilfe, sondern es geht hier eher um idealisierte Elternrepräsentanzen in unterschiedlicher symbolischer Ausgestaltung. Als hilfreiche Wesen können z. B. Tiere, Feen, Zauberer, Märchengestalten, Helden, Königinnen und Könige, weise Männer und Frauen imaginiert werden, die so in Erscheinung treten, wie das Kind es gebraucht hätte und noch braucht. Mit dem richtigen Begleiter an der Seite können Konflikte gelöst, Entwicklungshemmnisse überwunden, gute innere Objekte wiederbelebt oder neu aufgebaut und so Defizite im Sinne einer nachholenden Entwicklung aufgefüllt werden.
Für die implizite Behandlungstechnik ist das intersubjektive Verständnis des Behandlungsprozesses von besonderer Bedeutung. Die symbolische Darstellung der inneren Welt in der Imagination erfolgt immer in einem Beziehungskontext. Der Therapeut wird berührt und involviert, auf der bewussten wie auf der unbewussten Ebene. Er begleitet die Imagination des Patienten immer auch mit eigenen Imaginationen. Die Dynamik von Übertragung und Gegenübertragung und die Kommunikation der beiden Unbewussten zeigt sich besonders eindrücklich, wenn der Patient etwas imaginiert und mitteilt, an das der Therapeut gerade gedacht hat. Die Übertragungs-Gegenübertragungs-Dynamik »bildet den Rahmen für die hilfreiche Beziehung in der KIP. Der Therapeut begleitet, stellt eine ›haltende Umgebung‹ zur Verfügung, interveniert. Auf diesem Hintergrund gelingt es dem Patienten im günstigsten Fall, neue Erfahrungen mit inneren und äußeren Objektbeziehungen zu machen, auf der imaginativen Ebene neue Verhaltensoptionen zu erproben und symbolisches Erleben als Ressource zu nutzen« (Dieter, 2015, S. 63). Entscheidend sind die Reinszenierung des Vergangenen in der Gegenwart, die sog. »Szene« sowie die Konzentration auf das »Hier und Jetzt« der Übertragungsbeziehung.
Wie aber funktioniert das genau? Eine Antwort darauf findet man in dem Titel eines von Salvisberg, Stigler und Maxeiner (2000) herausgegebenen Buches: »Erfahrung träumend zur Sprache bringen«. Frühe Erfahrungen, die weder bewusst noch sprachlich fassbar sind, aber dennoch als Schemata das Denken, Fühlen und Verhalten wirksam beeinflussen, können genauso wie verdrängte Erfahrungen über sinnliches Erleben und Bilder in Sprache überführt werden. Stigler und Pokorny (2000) untersuchten in einer Einzelfallstudie anhand von Therapieprotokollen mit und ohne Imagination, welche Art von Vokabular in den verschiedenen Sequenzen benutzt wird. Den untersuchten Hypothesen lag das von Mergenthaler und Bucci (1999) postulierte 3-Phasen-Modell der therapeutischen Verständigung zugrunde: Emotionales und implizites Erleben muss aktiviert, bildlich oder narrativ übersetzt und schließlich reflektiert werden. In der Studie konnte bestätigt werden, dass in den KIP-Sitzungen mehr Primärprozess-Vokabular, mehr Emotions-Vokabular und mehr auf referentielle Aktivität hinweisendes Vokabular enthalten war als in den Sitzungen ohne Imagination (Stigler & Pokorny, 2000). Demnach entspricht die KIP dem von Mergenthaler und Bucci (1999) postulierten Modell der therapeutischen Verständigung: »Es werden emotionale und prozedurale Schemata aktiviert, diese gelangen über bildliche Szenarien zum Ausdruck und durch deren narrative Einfassung zur Mitteilung, bevor sie Gegenstand gemeinsamer Reflektion werden« (Stigler & Pokorny, 2000, S. 99). Kurz: Es geht vom inneren Erleben über das Bild zum Wort. So betont auch Ullmann (2012b) die Verbindung von Vorstellungen, Emotionen und körperlichen Vorgängen als wesentliches Wirkelement von Psychotherapie.
»In der KIP hat sich ein tiefenpsychologisches Konzept etabliert, das in der affekt- und primärprozessnahen Imagination auf regressivem Erlebnisniveau Möglichkeiten der emotionalen und kognitiven Nachreifung eröffnet. Das methodische Vorgehen stellt einen mnestischen Prozess besonderer Art dar, der im Hier und Jetzt des dialogisch begleiteten Tagtraums an frühen Beziehungserfahrungen anknüpft, Anlass zum Aufbau von neuen Gedächtnisinhalten gibt und zu strukturellen Veränderungen führt« (Ullmann, 2012b, S. 70).
Unter neurobiologischen Aspekten ist insbesondere die Neuroplastizität des Gehirns hervorzuheben. Damit ist »die Fähigkeit eines Nervensystems, sich an die Anforderungen der jeweiligen Umgebung anzupassen« (Ullmann, 2012b, S. 73) gemeint. Das Festhalten von Lernergebnissen und die Anpassung an neue Verhältnisse vollzieht sich auf der Ebene des Nervengewebes, und dies »ist die Basis für ein erfahrungsbasiertes Beurteilen und Bewältigen von Situationen, zusammen mit dem Einprägen der zugehörigen Erfolgs- und Misserfolgsgeschichte« (ebd., S. 73). Das Gehirn ist also kein fertiges Produkt, das zwangsläufig immer gleich funktioniert, sondern es ist glücklicherweise in der Lage, Anpassungsleistungen zu vollbringen, sodass Psychotherapie »unter neurobiologischen Gesichtspunkten als ein Prozess des Lernens, Übens und Umdenkens betrachtet werden [kann]« (ebd., S. 73). »Prägende Erfahrungen« sind damit auch jenseits der frühen Kindheit möglich.
Mit der besonderen Art der Imaginationen in der KIP werden unterschiedliche Gedächtnissysteme angesprochen, neben dem expliziten oder deklarativen, an die Sprache gebundenen Gedächtnis, haben wir auch Zugang zum impliziten oder nichtdeklarativen Gedächtnis. Dem »impliziten Wissen«, einschließlich des »Bewegungswissens«, des »Ähnlichkeitswissens« und des »Wiedererkennungswissens«, können wir in der katathymen Imagination mit sprachlichen Mitteln begegnen und so zur Episodenaktivierung beitragen.
2.3 Wirksamkeitsstudien KIP
Für die KIP bzw. das Katathyme Bilderleben (KB) liegen aktuell drei naturalistische Wirksamkeitsstudien vor. In einer 2003 veröffentlichen Studie (v. Wietersheim, Wilke & Röser) wurden große Effekte für die Verbesserung von depressiver Verstimmung und Lebenszufriedenheit nachgewiesen. Sachsse, Imruck und Bahrke (2016) konnten sehr große Effekte für die Verbesserung von Symptombelastung und interpersonellen Problemen nachweisen. In einer österreichischen Stichprobe konnten klinisch signifikante Veränderungen bei 37,7 % der Untersuchten festgestellt werden (Sell, Möller & Taubner, 2017).
Inzwischen richtet sich das Forschungsinteresse darauf, Therapieprozesse im Detail zu untersuchen und herauszufinden, wann genau der Einsatz von katathymen Imaginationen sinnvoll und wirkungsvoll ist. Ein aktuelles Forschungsprojekt zu dieser Thematik wird von der Universität Kassel durchgeführt (»Zentrale Einsatzkriterien und Wirksamkeit der KIP im Rahmen tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie«).
Читать дальше