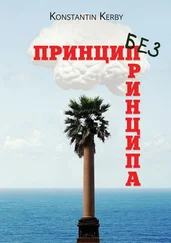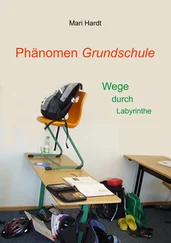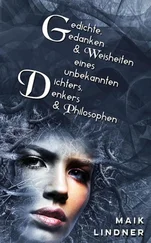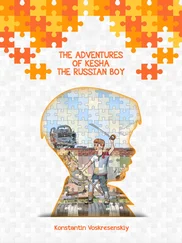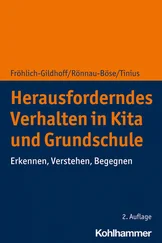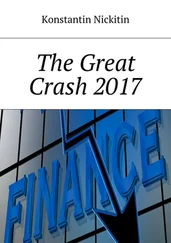Konstantin Lindner - Religionsdidaktik Grundschule
Здесь есть возможность читать онлайн «Konstantin Lindner - Religionsdidaktik Grundschule» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Religionsdidaktik Grundschule
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Religionsdidaktik Grundschule: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Religionsdidaktik Grundschule»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mit seinen grundsätzlichen Klärungen und vielen didaktischen und methodischen Anregungen legt es das Fundament für einen guten Religionsunterricht.
Religionsdidaktik Grundschule — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Religionsdidaktik Grundschule», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Zusammenfassung:
Religiöse Bildung vollzieht sich seit geraumer Zeit nicht mehr auf der Basis einer geschlossenen und bewusst kirchlichen Einstellung oder einer christlichen familialen Erziehung. Infolge gesellschaftlicher Modernisierung ergeben sich komplexe Individualisierungs-, Pluralisierungs- und Globalisierungsprozesse, die auch die Religion betreffen: Für die Einzelnen stellt sich das, was heute Religion ist, komplex, uneindeutig und vielfältig dar. Gleichwohl wächst so der religiöse Orientierungs- und Bildungsbedarf von Kindern. Religiöse Bildung kann sich nicht an diesen Prozessen vorbei ereignen. Dabei kommt es darauf an, die Veränderungen im positiven Sinne als Herausforderungen und Chance für religiöse Bildung zu sehen. Damit Kinder sich religiös bilden können, ist es konstitutiv, dass sie die vielgestaltige (christliche) Religion im Sinne kultureller Partizipation sinnenhaft kennenlernen; des Weiteren ist es für religiöse Bildung unentbehrlich, den Blick von Kindern über den eigenen »religiösen Gartenzaun« zu fördern und zu üben. All dies geschieht in der Absicht oder besser in der Hoffnung, dass sich Kinder mit der Unterstützung des Religionsunterrichts in, mit und unter solcher Begegnung mit Religion(en) religiös bilden, nach Möglichkeit ihre Religiosität finden und gestalten.
Lesehinweise:
ENGLERT, RUDOLF (2002): Dimensionen religiöser Pluralität. In: SCHWEITZER, FRIEDRICH u. a.: Entwurf einer pluralitätsfähigen Religionspädagogik. Gütersloh / Freiburg, 17–50.
SCHWAB, ULRICH (2002): Eltern, Kinder und die Religion. In: WERMKE, MICHAEL (Hg.): Aus gutem Grund: Religionsunterricht. Göttingen, 34–43.
WORLD VISION DEUTSCHLAND (Hg.) (2010): Kinder in Deutschland 2010. 2. World Vision Kinderstudie. Frankfurt a. M., 16–33.
I.3 Kinder und ihre religiöse Entwicklung: Entwicklungspsychologische Befunde
Georg Hilger / Eva Stögbauer
»Was tun Sie«, wurde Herr K. gefragt, »wenn Sie einen Menschen lieben?« »Ich mache einen Entwurf von ihm«, sagte Herr K., »und sorge, daß er ihm ähnlich wird.« »Wer? Der Entwurf?« »Nein«, sagte Herr K., »der Mensch.«
Diese bekannte Keuner-Geschichte von Bertolt Brecht lässt sich umtexten zu einer religionsdidaktischen Prüfungsfrage: »Was tun Sie«, wurde Frau K. gefragt, »wenn Sie bei Ihrer Unterrichtsplanung an die Kinder in der Klasse 3 denken?« »Ich mache mir Gedanken darüber, was sie lernen sollen, und mache mir Vorstellungen darüber, wie sie sich entwickeln sollen«, sagte Frau K., »und sorge, dass sie ihnen ähnlich werden.« »Wer? Die Vorstellungen?« »Nein«, sagte Frau K., »die Kinder.«
Was sich hier als wohlmeinende, aber problematische pädagogische Orientierung am Kind darstellt, wird von der italienischen Ärztin und Reformpädagogin Maria Montessori (1870–1952) scharf kritisiert als Blindheit von Erwachsenen für die Andersartigkeit des kindlichen Denkens und dessen Eigenheiten: Der Erwachsene sei »in seinem Verhältnis zum Kind egozentrisch – nicht egoistisch, aber egozentrisch. Alles, was die Seele des Kindes angeht, beurteilt er nach seinen eigenen Maßstäben […]. Von diesem Blickpunkt aus erscheint ihm das Kind als ein leeres Wesen, das der Erwachsene mit etwas anzufüllen berufen ist […]. Schließlich fühlt sich der Erwachsene als Schöpfer des Kindes […], wird zum Maßstab von gut und böse« (vgl. MONTESSORI 1967, 27).
Haben Kinder ein Recht auf eigenes theologisches Denken und Fragen? Doch sind sie dazu überhaupt in der Lage? Gibt es bei aller individuellen Unterschiedlichkeit kindlichen Denkens entwicklungspsychologische Erkenntnisse, die helfen können, Kinder in ihrem Entwicklungsstand besser wahrzunehmen und zu fördern, ohne sich vorschnell ein Bild von ihnen zu machen?
Wie Kinder glauben und theologisieren, sich z. B. mit ihren Gottesvorstellungen auseinandersetzen und sie aufbauen, ist eine recht junge Frage (s. III.2). Kindern zuzugestehen, eine eigene Theologie aktiv zu entwerfen bzw. zu konstruieren (vgl. u. a. SCHAMBECK 2005), setzt nämlich eine Anthropologie voraus, die anerkennt, dass Kinder anders sind als Erwachsene und sich auf eigene Weise mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzen (s. II.8). Kinder sind nicht mehr als leere Gefäße zu betrachten, die zu füllen wären, sondern als religiös und theologisch kompetente Subjekte (vgl. u. a. METTE 1996; BUCHER 1996).
In diesem Kapitel wird diesen Fragen nachgespürt in der Absicht, die Wahrnehmungsfähigkeit für Eigenheiten kindlichen Denkens zu fördern. Dabei wird das Kind weder als eine theologische Tabula rasa gesehen noch als ein passiv reifendes Wesen, sondern als ein von Anfang an aktives und zugleich soziales Wesen, das auf religiöse Kommunikation angewiesen ist und dessen religiöse Entwicklung stimuliert werden kann.
1. Was heißt religiöse Entwicklung?
Wer von religiöser Entwicklung spricht, setzt schon implizit voraus, dass es eine progressive religiöse Entwicklung in unterscheidbaren Phasen bzw. Stufen gibt und dass jeder Mensch in seiner Religiosität bzw. seinem Glauben entwicklungsfähig ist. Hierbei werden im Hinblick auf religiöses Lernen langfristige Veränderungen insbesondere einer sich ausdifferenzierenden Denkentwicklung in den Blick genommen – im Unterschied zu kurzfristig erreichbaren unterrichtlichen Lerneffekten. »Entwicklung« betont ferner die Eigenaktivität des sich aktiv entwickelnden Subjekts und enthält in seinem Menschenbild auch die Idee des mündigen religiösen Menschen (vgl. BUCHER 1999a).
Dieses Kapitel beschränkt sich auf zwei Theorien religiöser Entwicklung, die im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahrzehnten intensiv diskutiert wurden und in enger Beziehung zu den entwicklungspsychologischen Forschungen von Jean Piaget (1896–1980) stehen: Theorien zur Entwicklung des religiösen Urteils nach Fritz Oser und Paul Gmünder und zu den Entwicklungsstufen des Glaubens nach James W. Fowler.
Zu den Grundannahmen von genetisch-strukturellen Entwicklungstheorien, die auf Piaget zurückgehen, gehört: Kinder und Jugendliche denken anders und verarbeiten das an sie (z. B. im Unterricht) Herangetragene anders als Erwachsene. Anders denken heißt nicht, fehlerhaft oder sogar falsch zu denken; die unterschiedlichen Denkweisen müssen vielmehr an- und ernst genommen werden, damit die Impulse zur eigenen Weiterentwicklung greifen können. Ferner gilt: Denken entwickelt sich nicht durch Belehrungen, sondern dadurch, dass die Lernenden ihr Denken durch den Aufbau von neuen Strukturen umstrukturieren.
Piagets Modell der Entwicklung des logisch-mathematischen Denkens umfasst vier Stufen: sensomotorisch (erstes Lebensjahr), präoperatorisch (bis ca. 6 Jahre), konkret-operatorisch (bis ca. 12 Jahre) und schließlich formal-operatorisch. Entwicklung erfolgt dann, wenn ein Sachverhalt nicht mehr in die bestehenden kognitiven Strukturen eingefügt bzw. integriert werden kann (Assimilation) und eine Anpassung (Akkommodation) der Strukturen notwendig ist, damit im Wechselspiel von Assimilation und Akkommodation das Gleichgewicht (Äquilibrium) wiederhergestellt wird. Das Gleichgewicht ist gestört, wenn die vorhandene Denkstruktur nicht mehr ausreicht, um eine neue kognitive Herausforderung (z. B. durch eine Dilemmageschichte s. u.) zu bewältigen. Das Streben nach Gleichgewicht (Äquilibration) wird somit zum Motor für die Denkentwicklung. Dieser Prozess findet auch innerhalb der religiösen Denkentwicklung statt, die durch kognitive Konflikte und Zweifel angetrieben wird (vgl. BUCHER 2007a).
Entwicklung des religiösen Urteils nach Fritz Oser und Paul Gmünder
Religionspädagogisch inspirierte entwicklungspsychologische Forschungen im Sinne von Jean Piaget (z. B. durch F. Oser, P. Gmünder, J.W. Fowler) haben bestätigt, dass Kinder und Jugendliche auch im religiösen Bereich als aktive Subjekte ihrer Entwicklung anzusehen sind. Das lernende Subjekt muss die Inhalte des Religionsunterrichts aktiv in sich aufnehmen und verarbeiten, gewissermaßen sich einverleiben (assimilieren) gemäß seiner kognitiven Entwicklung; nur so werden sie bedeutsam, und nur so können sich Erkenntnisstrukturen entwickeln und dem neuen Bewusstseinsstand angepasst (akkommodiert) werden (vgl. u. a. OSER / GMÜNDER 1984). Fritz Oser und Paul Gmünder nehmen in ihrer Arbeit die Entwicklung des religiösen Urteils in den Blick. Unter religiösem Urteil verstehen die beiden Forscher die Art und Weise, wie eine Person ihre Selbst- und Welterfahrung in Bezug auf ein Ultimates deutet. Um diese Argumentationsstrukturen zu erforschen, legten die beiden Wissenschaftler Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Alter von 8 bis 75 Jahren verschiedene Dilemmageschichten vor. In der Literatur bekannt geworden ist vor allem das sogenannte Paul-Dilemma:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Religionsdidaktik Grundschule»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Religionsdidaktik Grundschule» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Religionsdidaktik Grundschule» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
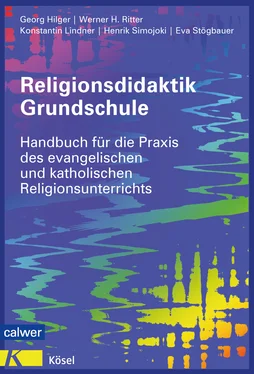
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)