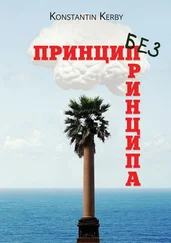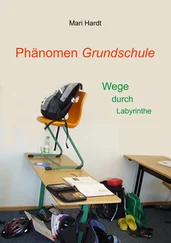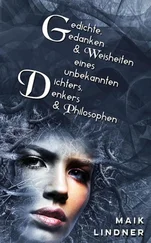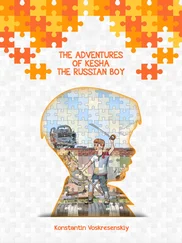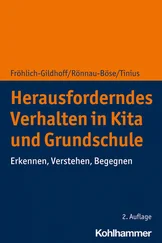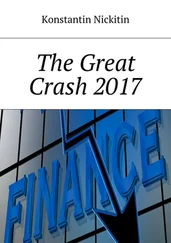Konstantin Lindner - Religionsdidaktik Grundschule
Здесь есть возможность читать онлайн «Konstantin Lindner - Religionsdidaktik Grundschule» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Religionsdidaktik Grundschule
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Religionsdidaktik Grundschule: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Religionsdidaktik Grundschule»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mit seinen grundsätzlichen Klärungen und vielen didaktischen und methodischen Anregungen legt es das Fundament für einen guten Religionsunterricht.
Religionsdidaktik Grundschule — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Religionsdidaktik Grundschule», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Kinderleben in Deutschland findet mehr und mehr in Schulen statt. Gerade in den Medien dominiert hier der Krisenjargon: Der PISA-Schock und die medienwirksamen Berichte aus großstädtischen Brennpunktschulen erwecken den Eindruck einer aus den Fugen geratenen Institution. Die Kinder denken hier ganz offenbar mehrheitlich anders: In der World Vision Kinderstudie äußern sich 70 % Mehrheit der befragten Kinder positiv im Blick auf die Schule, 22 % geben sich neutral und insgesamt nur 8 % sind unzufrieden, wobei die Zufriedenheitswerte bei den Mädchen durchgängig höher liegen.
Auf allgemeiner Ebene ergibt sich bei den Freizeitaktivitäten von Kindern ein erwartbares Bild: Freunde treffen, Sport treiben und Radfahren sind die drei am häufigsten genannten Freizeitaktivitäten, gefolgt von: Musik hören, mit Spielzeug spielen und Fernsehen. Der besondere Stellenwert von Sport zeigt sich auch auf der Ebene von Gruppenaktivitäten: 62 % der Kinder betätigen sich in einem Sportverein, 21 % engagieren sich in einer Musikgruppe und als Drittes machen immerhin 11 % bei einer Kirchengruppe mit.
Es ist sicher für niemanden überraschend, dass die Nutzung von Medien in Deutschland inzwischen ein selbstverständlicher Bestandteil der Kindheit ist. Allerdings ist die von den Kindern frequentierte Medienpalette dann doch traditioneller als man es im digitalen Zeitalter vermuten würde. Im Kinderzimmer dominieren noch immer der CD-Spieler und das Radio, dann folgen Gameboy und Spielkonsole, während der Computer überraschend weit unten steht, noch hinter dem Fernsehen, der bei einem Drittel aller Zehn- und Elfjährigen bereits im Kinderzimmer zu finden ist. Was besonders auffällt: Im Unterschied zum Jugendalter spielt das Internet im Alltag der Kinder (noch) eine überraschend geringe Rolle (s. III.14).
In ihrem Gesamtfazit haben die Autoren der 2. World Vision Kinderstudie die derzeitige Situation von Kindern in Deutschland auf eine prägnante Formel gebracht: Sie sprechen vom Kinderleben in einer »Vier-Fünftel-Gesellschaft«. Demnach geht es der jüngsten Generation ihrer eigenen Einschätzung nach mehrheitlich erfreulich gut. Die Kinder sind zumeist ausgesprochen zufrieden mit ihrem Leben und Aufwachsen. Gleichwohl gibt es hinsichtlich der Lebensbedingungen und der Selbstwahrnehmung eine erschreckend große Kluft zwischen der großen Mehrheit und einer nicht eben kleinen Minderheit von etwa 20 %. Diese Kinder sind von den Ressourcen, die für eine gedeihliche Entwicklung wichtig sind, teilweise ausgeschlossen und nehmen dies, was das Ganze noch gravierender macht, auch so wahr. Sie äußern sich weniger positiv hinsichtlich der elterlichen Zuwendung, bewerten die Schule deutlich negativer, sind in ihrer Freizeit weniger vielseitig aktiv, verbringen mehr Zeit vor dem Fernseher oder bei Computerspielen und haben insgesamt deutlich mehr Zukunftsängste als die Mehrheit ihrer Altersgenossen.
4. Kinder und Religion
Wenn sich nicht nur die Religion verändert hat, sondern auch die Kindheit, was heißt das für Kinder und Religion heute? Der primäre Ort, an dem sich die religiösen Einstellungen von Kindern heute formieren, ist zweifellos die Familie. Wie später ausführlich dargestellt wird (s. II.9), haben sich die religiösen Sozialisationsvoraussetzungen in deutschen Familien grundlegend verändert, und zwar ganz im Sinne der oben entfalteten Individualisierungsthese. Nicht mehr die Kirche bestimmt die Religiosität der Familie, sondern umgekehrt: Die Eltern bestimmen ihren Nähe- oder Distanzgrad zur Kirche selbst, nach ihren eigenen Interessen, Erwartungen und Bedürfnissen. Eine bewusste religiöse Erziehung findet vielfach kaum mehr statt, was mehrere Gründe hat: Zum einen wollen die Eltern jeglichen Zwang vermeiden, zum anderen fühlen sie sich auf diesem Gebiet wenig kompetent (vgl. SCHWEITZER / BIESINGER 2009). Das aber heißt nicht, dass Kindheit heute religionslos ist. Kinder kennen in der Tat nicht mehr so viele biblische Geschichten, Gesangbuchlieder, Gebete etc. und haben nicht mehr das traditionelle religiöse Wissen wie vor 30 oder 40 Jahren. Jedoch bedeutet der unverkennbare Ausfall an explizit christlich-religiösen Vorprägungen und Vorstellungen nicht, dass Kinder an religiösen Fragen uninteressiert wären. Gerade Grundschulkinder erscheinen als religiös sehr ansprechbar und begeisterungsfähig (vgl. ENGLERT / SCHWEITZER 2003, 71). Sie fragen und artikulieren sich religiös, weil sie auf fundamentale und elementare Zusammenhänge in ihrem Leben stoßen, die mit Religion, mit dem Woher und Wohin zu tun haben (s. II.8). Zudem fragen Kinder heute offenkundig entschieden pragmatischer nach dem Gebrauch und Nutzen von Religion als früher. Insgesamt resultiert daraus eine wesentlich höhere Eigen- und Selbstständigkeit von Kindern in religiösen Dingen. Dies gilt auch dann und dort, wo Kinder auf in ihren Familien vorhandene (christlich-)religiöse Vorstellungen und Themen zurückgreifen können.
Dabei ist religiöse Ansprechbarkeit nicht zu verwechseln mit religiöser Sprach- und Ausdrucksfähigkeit. Wenn man in diesem Zusammenhang immer wieder von Kindern als »religiösen Analphabeten« spricht, dann meint man damit in aller Regel nicht nur mangelnde Kenntnis in Sachen christlicher Tradition, sondern vor allem auch die relative Sprachlosigkeit angesichts der religiösen Dimension unseres Lebens (s. II.2). Zudem ist kindliche Religiosität oft – wie die der Erwachsenen – »unbestimmt«, eher eine Religion des Fühlens und Meinens als eine Religion des Glaubens. Religiöse Bildung will Kinder in dieser ihrer Befindlichkeit nicht allein lassen, sondern sie auf ihrer Suche nach Sinn unterstützen und ihnen Zeit-Raum zur religiösen Findung, Orientierung und Expression gewähren. Hilfreich ist dabei, dass Kinder weithin ein fast »natürliches« Interesse an religiösen Themen und Dingen haben, über die sie »anders als Erwachsene ganz unbefangen kommunizieren wollen« (EKD 2000, 7). Das in diesem Zusammenhang oft vorgebrachte Argument, man könne Kindern im Religionsunterricht vor allem deshalb nichts beibringen, weil sie vom Elternhaus her nicht oder zu wenig religiös erzogen würden, sticht daher nur sehr bedingt. Unterschätzt werden die Eltern häufig im Hinblick auf ihre Vermittlung von elementaren religiös relevanten Grunderfahrungen wie der Erfahrung des unbedingten Angenommenseins und der Erfahrung von Verlässlichkeit und Vertrauen (s. I.9). Im Übrigen würde keine Sport-, Deutsch- oder Musiklehrkraft nur deswegen ihr Fach nicht schulisch unterrichten, weil die Eltern zu Hause mit ihrem Kind nicht turnen, Bücher lesen oder musizieren.
5. Herausforderungen und Chancen religiöser Bildung heute
Oben genannte Veränderungen sind religiöser Bildung aufgegeben. Wir können weder hinter sie zurück noch können wir sie überspringen. Wie also damit religionspädagogisch umgehen? Wir können diese Veränderungen als radikale Bedrohung des christlichen Glaubens und entsprechend als eminente Belastungsposten und Probleme für religiöse Bildung einstufen, wir können sie aber auch als große Herausforderung und Chance für religiöse Bildung heute begreifen. Wir sind hier der Auffassung, dass man die (religiös) individualisierte, pluralisierte, globalisierte und veränderte Situation von Kindern nicht einfach als defizitär, sondern als gewandelt (und sich noch im Wandel befindlich) verstehen sollte. Anliegen religiöser Bildung heute ist, dass Religionslehrkräfte und Kinder – auf der Suche nach Orientierung und Sinn (s. I.1) – Religion gemeinsam lernen und sie so kommunizieren, dass sie (nicht nur die Kinder!) sich selbst religiös bilden können. Religiöse Bildung muss also die aus dem religiösen und gesellschaftlichen Wandel herrührenden Anforderungen an Religion nicht nur notdürftig akzeptieren, sondern sollte sie positiv aufnehmen und religionspädagogisch gestalten. Wenn Religionslehrkräfte die genannten Veränderungen generell als schlecht und defizitär empfinden und von früheren, religiös »besseren« Zeiten schwärmen, erzeugen sie nicht nur bei Grundschülern ganz schnell das Gefühl der Fremdheit und der Geringschätzung. Schülerinnen und Schüler, denen von Religionslehrkräften signalisiert wird, dass Menschen – Kinder sowieso – heute nicht mehr oder zu wenig religiös seien und zu wenig glaubten, werden in eine relativ aussichtlose Situation gebracht: Ihre Bereitschaft zu und Lust an religiösem Lernen und religiöser Bildung wird dadurch nicht gefördert, sondern dezimiert und deprimiert. Demgegenüber meinen wir: Was christlicher Glaube und Religion heute sind, »ist notwendig, aber nicht hinreichend an der Vergangenheit abzulesen«, sondern muss von jeder Zeit immer wieder neu buchstabiert und geklärt werden (vgl. HEIL / ZIEBERTZ 2003, 297).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Religionsdidaktik Grundschule»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Religionsdidaktik Grundschule» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Religionsdidaktik Grundschule» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
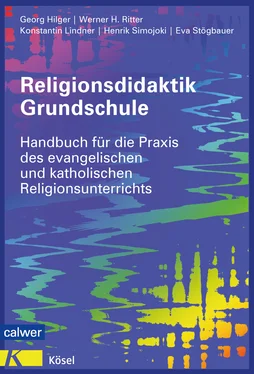
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)