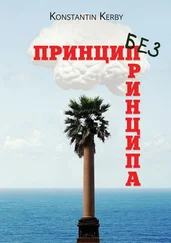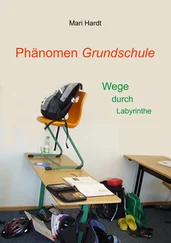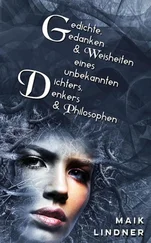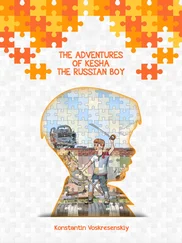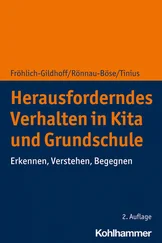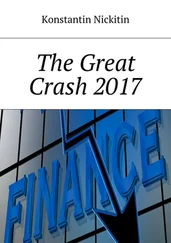Konstantin Lindner - Religionsdidaktik Grundschule
Здесь есть возможность читать онлайн «Konstantin Lindner - Religionsdidaktik Grundschule» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Religionsdidaktik Grundschule
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Religionsdidaktik Grundschule: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Religionsdidaktik Grundschule»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mit seinen grundsätzlichen Klärungen und vielen didaktischen und methodischen Anregungen legt es das Fundament für einen guten Religionsunterricht.
Religionsdidaktik Grundschule — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Religionsdidaktik Grundschule», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Bis vor wenigen Jahrzehnten war es üblich, diesen eben beschriebenen Wandel von Religion auf der gesamtgesellschaftlichen, kulturellen (aber auch individuellen) Ebene als Säkularisierung zu bezeichnen. Darunter verstand man – und versteht teilweise noch immer –, dass mit fortschreitender Modernisierung von Gesellschaften zwangsläufig ein Bedeutungsverfall, ja vielleicht sogar das Ende von Religion einhergehe. Seit geraumer Zeit wird dieses Säkularisierungsverständnis sozialwissenschaftlich, religionswissenschaftlich und theologisch kritisiert: Es gilt, da es einen direkten Zusammenhang zwischen Modernisierung und Religion unterstellt, als zu wenig differenziert und der Vielschichtigkeit der tatsächlichen Zusammenhänge nicht gerecht werdend (vgl. ZIEBERTZ 2002b). Eher sieht es danach aus, dass Religion gesellschaftlich vielfältig präsent ist – unsichtbare Religion, privatisierte Religion, transformierte Religion usw. – und auch zur modernen Wirklichkeit und zum Leben vieler Menschen gehört (vgl. GABRIEL 2002, 142 f.), gerade in ihrer individualisierten und pluralisierten Gestalt.
Doch auch wenn der mancherseits erwartete konsequente Niedergang der Religion in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt nicht eingetreten ist, also das Ende der Religion keineswegs nahe ist, haben sich dennoch die Dinge stark verändert. Zu reden ist zum einen von Verlusten des christlichen Glaubens: Die Säkularisierungsthese lässt sich in Europa zu einem gewissen Teil empirisch bestätigen (vgl. POLLACK 2003; LEHMANN 2004). So haben die traditionellen Kirchen vor allem im westlichen Europa seit den 1970er-Jahren einen erheblichen Mitgliederverlust hinnehmen müssen. Deutlich ist auch, dass die Zahl sogenannter Konfessionsloser, die sich weder einer Konfession noch Religionsgemeinschaft zugehörig wissen, erheblich gewachsen ist, besonders in Ostdeutschland, wo sich nach dem Zweiten Weltkrieg graduell eine Mehrheitskultur der Konfessionslosigkeit etabliert hat.
Jedoch hat sich im Verlauf der Neuzeit nicht nur das Verhältnis von christlicher Religion und Kultur verändert. Gewandelt hat sich auch das Christentum selbst: Es ist längst keine einheitliche Größe mehr, sondern eine plurale Erscheinung, die sich in viele Konfessionen und Denominationen ausdifferenziert; auch die einzelnen christlichen Konfessionen sind keine monolithischen Einheiten, sondern facettenreiche Größen. Vor allem durch die Aufklärungsepoche mitbedingt, treten kirchenoffizielle Religion und private Religiosität des bzw. der Einzelnen in der Moderne auseinander. Phänomenologisch können drei Erscheinungsformen des Christentums benannt werden: Neben einer kirchen- und kerngemeindlichen Christlichkeit kennen wir seit geraumer Zeit ein individuell-privates und ein kulturell-öffentliches Christentum (vgl. RÖSSLER 1994). Eine weitere auffällige Folge neuzeitlich bedingter Veränderungen von Christentum und Religion ist, dass Religion aus dem angestammten Ort Kirche aus- und in andere Orte des Lebens einwandert. Wir sprechen von Ortsverschiebungen von Religion. In diesem Zusammenhang ist man auf die verborgenen Gestalten von Religion und Religiosität mitten in unserer weltlichen Wirklichkeit aufmerksam geworden: in Kunst, Literatur, Musik, Sport, Werbung, Medien, Tourismus, im öffentlichen und politischen Leben etc. Auch hierin zeigt sich, wie Menschen das Religionsmonopol, das die Kirche lange Zeit hatte, sich selbst aneignen und damit ihre religiöse Autonomie und Unabhängigkeit reklamieren.
Gerade die modernen veränderten Gestalten des Christentums, welche die kirchlich institutionalisierte Religion und den individuellen Glauben auseinandertreten lassen, zeigen, dass das Christentum sich nicht einfach in einem Eliminierungsprozess befindet. Freilich werden diese Veränderungsprozesse oft allzu einseitig negativ beurteilt, nämlich ausschließlich am Maß der kirchlichen Gestalt des Christentums. Die Identifikation von Religion und Religiosität mit bestimmten überlieferten und bekannten Formen kirchlichen Christentums lässt weder die Dynamik des religiösen Feldes noch die breite Präsenz religiöser Phänomene in den Blick kommen. Sie führt zudem zu vermeintlich empirischen Ergebnissen, die – infolge ihrer Grundannahme – einen kontinuierlichen Rückgang kirchlicher Bindung und kirchlicher Gläubigkeit meinen feststellen zu müssen. Nicht zuletzt werden mit solchen Defizit-Beobachtungen, die nur das Verschwinden des christlichen Glaubens konstatieren, keine religionsdidaktischen Perspektiven eröffnet, die eine Kommunikation zwischen alltagsweltlicher Religion und Religiosität von Menschen sinnvoll erscheinen lassen. Gerade auf Letzteres käme es aber an.
Religion als individuelle Entscheidung und als subjektive Leistung
Religiöse Individualisierung und Pluralisierung begegnen uns schließlich auf der Ebene des bzw. der einzelnen Menschen und sind wesentliche Merkmale von Religion und Religiosität heute in der sogenannten Postmoderne. Religiöse Individualisierung ist dabei gleichsam die Folge bzw. die Kehrseite religiöser Pluralisierung. Konkret heißt dies: Die noch bis in die 1950er/ 60er-Jahre hinein begegnenden sogenannten geschlossenen religiösen Milieus katholischer wie evangelischer Provenienz schwinden erheblich, und stattdessen wird oft das Allgemein-Christliche und / oder die individuelle Freiheit betont. Zudem treffen Menschen schon von Kindesbeinen an mit anderen Kulturen zusammen und wachsen damit auf. Religiöse Pluralisierung meint den Prozess, in dem den Einzelnen religiöse Orientierungen und Einstellungen in vielfältigen Gestalten begegnen. Dies betrifft sowohl den inneren Pluralismus des Christentums mit seinen verschiedenen Gruppierungen und Konfessionen wie auch die äußere religiöse Pluralität einer multireligiösen Gesellschaft. Menschen sind – wie auch immer – von pluralen Religions- und Sinnsystemen umgeben, angesichts derer sich ihr Aufwachsen und Leben vollzieht. So ist die religiöse Gegenwartskultur in europäischen und auch in vielen anderen Gesellschaften – wie sie der Einzelne wahrnimmt – im Unterschied zu der Zeit vor etwa 50 Jahren durch eine wachsende Vielfalt religiöser Orientierungen in ein und derselben Gesellschaft ausgezeichnet, Säkularisierungs-Schübe eingeschlossen. Für Heranwachsende und Erwachsene in unserer Gesellschaft hat dies zur Folge, dass sie christliche Religion und Kirche nicht mehr im gleichen Maße wie bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein als die einzige und die maßgebende Religion akzeptieren, von der sie sich ohne Weiteres exklusiv orientieren ließen und deren Autorität sie umstandslos akzeptierten (s. II.11).
Das andere markante Merkmal religiöser Gegenwartskultur in Europa und darüber hinaus besteht darin, dass sich der und die Einzelne angesichts innerer wie äußerer religiöser Pluralisierung in gesteigertem Maße selbst einen Reim auf ihre Religiosität machen und diese bis zu einem bestimmten Grade eigenständig »konstruieren« (müssen), wodurch die vorher stärker homogene (christliche) Religionslandschaft sich zusehends individueller und pluraler ausformt. Der bzw. die Einzelne lässt sich heute die persönliche religiöse Orientierung nicht allein durch Kirchen bzw. religiöse Institutionen und deren Traditionen vorgeben. Stattdessen wird Religion bzw. die Religiosität des Einzelnen zunehmend zu einer Sache der individuellen »Wahl« – eine Konsequenz aus der pluralen Situation. Der (Religions-)Soziologe Peter L. Berger spricht in diesem Sinne vom »häretischen Imperativ«, womit er die Situation einer angesichts religiöser Pluralität notwendig gewordenen religiösen Wahl für jeden Einzelnen in der Gesellschaft kennzeichnen will (vgl. BERGER 1980). Von individualisierter Religiosität zu reden – im Grunde eine Tautologie, weil Religiosität ohnehin die individuelle Seite von Religion bezeichnet –, ist dennoch sinnvoll, da die aktive Eigenbeteiligung des Einzelnen an seiner Religiosität, die es in irgendeiner (geringeren) Form schon immer gab, in unserer Zeit eminent an Bedeutung zugenommen hat. Moderne Religiosität hat demzufolge nicht mehr den Charakter einer schicksalhaft zugeborenen Sache, sondern wird vielmehr stärker vom Einzelnen entschieden. Zwar kann man sich auch weiterhin mit einer bestimmten ererbten religiösen Überlieferung total identifizieren, aber auch diese Identifikation muss »gewählt werden, bedarf deshalb irgendeiner Form der Begründung (d. h. sie wird reflektiert)« (BERGER 2000, 811). Mit der Entdeckung der eigenen Autonomie erheben die Individuen genauso Anspruch auf Wahrheit und Wirklichkeit, wie es die religiös kulturellen Überlieferungen tun. Menschen lehnen heute tendenziell jede (religiöse) Definitionsmacht über ihr Leben, egal woher sie kommt, ab und fühlen sich für ihre Religion und Weltanschauung sowie ihr Leben selbst zuständig. Sie nehmen sich also das Recht, ihre religiöse Anschauung selbst zu bilden. Was heute einer glaubt, glaubt er nicht bloß traditionell-konventionell, sondern »aus Überzeugung«. Deswegen zeichnet sich religiöse Individualisierung durch auswählendes Verhalten und persönliche Identifikationen mit bestimmten Glaubensinhalten aus.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Religionsdidaktik Grundschule»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Religionsdidaktik Grundschule» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Religionsdidaktik Grundschule» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
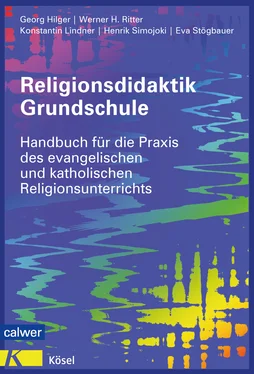
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)