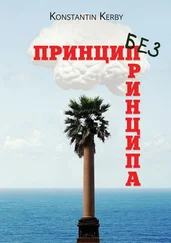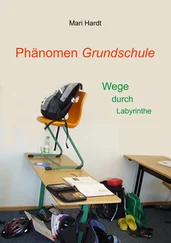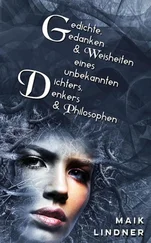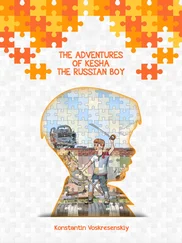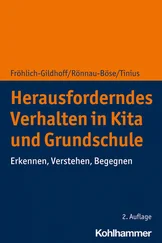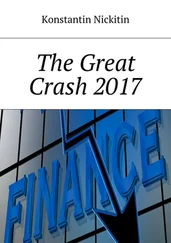Konstantin Lindner - Religionsdidaktik Grundschule
Здесь есть возможность читать онлайн «Konstantin Lindner - Religionsdidaktik Grundschule» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Religionsdidaktik Grundschule
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Religionsdidaktik Grundschule: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Religionsdidaktik Grundschule»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mit seinen grundsätzlichen Klärungen und vielen didaktischen und methodischen Anregungen legt es das Fundament für einen guten Religionsunterricht.
Religionsdidaktik Grundschule — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Religionsdidaktik Grundschule», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Hinzu kommt ein weiteres Argument, das in der öffentlich-politischen Bildungsdebatten häufig frequentiert wird und auch bei den Lehrkräften großen Rückhalt hat: Es verweist auf den gestiegenen Orientierungsbedarf pluralistischer Gesellschaften und begründet die Notwendigkeit eines schulischen Religionsunterrichts mit der wertebildenden Funktion dieses Faches (vgl. LINDNER 2012). So warb die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) im Vorfeld des Berliner Volksentscheides mit dem Motto »Werte brauchen Gott« für den Beibehalt eines konfessionellen Religionsunterrichts. Der letztlich negative Ausgang dieser Kampagne verweist auf die Grenzen des – an sich wichtigen – ethischen Arguments. Wie etwa Studien unter Konfessionslosen zeigen, sind solidarische Haltungen und prosoziale Orientierungen nicht zwingend an Religion gebunden. Zudem kann eine zu starke Betonung dieses Aspekts zu einer einseitigen Ethisierung des Faches führen. Der Religionsunterricht leistet zwar einen Beitrag zur Wertebildung, aber er geht nicht in dieser Aufgabe auf.
Die bisherigen Begründungen orientieren sich an der geschichtlich geronnenen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Dagegen setzt das anthropologische Argument grundsätzlicher an: Im Unterschied zum Tier kommt der Mensch instinktreduziert zur Welt, verfügt also über kein von Anfang an fertiges Verhaltens- oder Deutungsrepertoire hinsichtlich seiner Wirklichkeit. Weil er keine entsprechende »Sinnformel« für sich und seine Welt hat, muss er danach suchen, wozu er eine Lebens-Deutung, eine Welt-Anschauung oder ein Welt-Bild und – je nachdem – Religion braucht. Wenn wir nicht einfach in den Tag hinein leben, sondern uns unserer Existenz bewusst sein bzw. werden wollen, dann sei es sei es, so der Kinderpsychologe Bruno Bettelheim, auch »die wichtigste und schwierigste Aufgabe der Erziehung«, »dem Kind dabei zu helfen, einen Sinn im Leben zu finden« (BETTELHEIM 1977, 9). Allerdings darf auch dieser Begründungsansatz nicht überstrapaziert werden: Denn es ist seit geraumer Zeit unübersehbar deutlich, dass Menschen auch ohne Religion leben und leben können, ihr Leben also ohne wesentliche Defizite, wie sie sagen, organisieren und zubringen können (vgl. TIEFENSEE 2000). Dies zeigt sich in Westdeutschland und noch verstärkt in Ostdeutschland. Da wie dort stößt die Ansicht, Religion sei eine anthropologische Konstante, mehr oder weniger auf Unverständnis. »Die Möglichkeit religionsfreier Lebensführung ist als empirisches Faktum nicht zu bestreiten«, schreibt der Soziologe Niklas Luhmann und fügt hinzu, dass alle »anthropologischen Begründungen der Funktion der Religion« an diesem Tatbestand zusammenbrächen (LUHMANN 1989, 349). Religion ist eine wesentliche Möglichkeit des Menschen, aber kein »naturnotwendiger« anthropologischer Grundsachverhalt. Menschen können religiös sein – und die Mehrzahl ist es –, aber sie müssen es nicht. Dass Religion anthropologisch unverzichtbar und definitiv zum Menschen gehört, lässt sich also – summa summarum – weder sozialwissenschaftlich noch sonst wie allgemein gültig beantworten, da es Gründe dafür und dagegen gibt. Dies macht die Legitimation und Institutionalisierung religiöser Bildung in der Schule nicht unbedingt leichter, aber dafür realitätsnäher und ehrlicher.
Während die anthropologische Begründung auf die allgemeine »Fraglichkeit« des Menschen rekurriert, orientiert sich Friedrich Schweitzer in seinem Plädoyer für ein Recht des Kindes auf Religion und religiöse Begleitung an den »großen Fragen«, die im Aufwachsen der Kinder aufbrechen. Seiner Ansicht nach verlangen insbesondere fünf Fragen, die sich bereits Kindern stellen, nach einer potenziell religiösen Antwort:Wer bin ich und wer darf ich sein? Die Frage nach mir selbst.Warum musst du sterben? Die Frage nach dem Sinn des Ganzen.Wo finde ich Schutz und Geborgenheit? Die Frage nach Gott.Was ist gerecht? Die Frage nach dem Grund richtigen Handelns.Warum glauben manche Kinder an Allah? Die Frage nach der Religion des anderen.Die Tabuisierung solcher Fragen ist – so der Philosoph Vittorio Hösle – »ein Verbrechen an der kindlichen Seele« (NORA K./HÖSLE 1996, 247). Folglich ist, so das subjektorientierte Argument, eine gemeinsame Thematisierung solcher Fragen im Religionsunterricht um der Kinder und ihrer Selbstentfaltung willen notwendig.
Spätestens hier wird deutlich, dass sich die Frage nach der Berechtigung des Religionsunterrichts letzten Endes an seiner Bildungsbedeutung entscheidet, die in sämtlichen hier vorgetragenen Argumenten mitschwingt. Je mehr sich am Religionsunterricht zeigt, dass er heutigen Kindern bei der komplexen Aufgabe der Subjektwerdung wirklich hilft, dass er sie reicher an Wirklichkeit macht und ihre Sicht auf Andere und Anderes schärft, desto leiser werden die Diskussionen um seine Legitimität ausfallen.
Zusammenfassung:
Wer Religion in der Schule unterrichten will, sollte Auskunft darüber geben können, was unter Religion zu verstehen ist und inwiefern der Religionsunterricht zum Bildungsauftrag der Schule beiträgt. Das ist aber allein schon deshalb nicht einfach, weil beide Begriffe, Religion und Bildung, schillernd, mehrdeutig und umstritten sind. In der Debatte um den Religionsbegriff standen sich substanzielle und funktionale Religionsbestimmung lange Zeit unversöhnlich gegenüber. Neuerdings gibt es jedoch religionsdidaktisch anschlussfähige Versuche, beide Aspekte miteinander zu verbinden. Während der Religionsbegriff den Gegenstandbereich des Religionsunterrichts absteckt, verweist der Bildungsbegriff auf seinen Zielhorizont: den Prozess menschlicher Subjektwerdung im Kontext von Lebensgeschichte, Lebenswelt und Kultur. Die Frage nach dem Verhältnis von Religion und Bildung ist eine der zentralen Streitfragen der neuzeitlichen Bildungsdiskussion und steht im Zentrum der gegenwärtigen Debatte um den Religionsunterricht. Unter den Bedingungen der Pluralität kann der Religionsunterricht seinen Platz in der öffentlichen Schule nur behaupten, wenn einsichtig gemacht werden kann, dass er Kindern bei der komplexen Aufgabe der Subjektorientierung hilft. Die gängigen Begründungen des Religionsunterrichts akzentuieren verschiedene Dimensionen und Aspekte religiöser Bildung. Nicht für sich, aber zusammengenommen zeigen sie, dass Religion in ihrer subjektdienlichen, wirklichkeitserschließenden und weltorientierten Funktion unverzichtbar zur Bildung des Menschen dazugehört und daher aus dem Grundschulunterricht nicht wegzudenken ist.
Lesehinweise:
DRESSLER, BERNHARD (2002): Religiöse Bildung: Warum und Wozu? In: WERMKE, MICHAEL (Hg.): Aus gutem Grund: Religionsunterricht. Göttingen, 22–34.
KROPAČ, ULRICH (2013): Warum Religionsunterricht in der öffentlichen Schule? In: HELBLING, DOMINIK u. a. (Hg.): Konfessioneller und bekenntnisunabhängiger Religionsunterricht. Eine Verhältnisbestimmung am Beispiel Schweiz. Zürich, 142–159.
SCHRÖDER, BERND (2012): Religionspädagogik. Tübingen; hier: 196–231.
I.2 Religion und Kindheit im Wandel – Pluralisierung, Individualisierung, Globalisierung
Werner H. Ritter/Henrik Simojoki
Wer heute in der Grundschule mit der Aufgabe religiöser Bildung betraut ist, steht, verglichen mit den entsprechenden Voraussetzungen und Gegebenheiten vor vier bis fünf Jahrzehnten, vor einer stark veränderten Situation. Begegnete ein katholischer Dorfbewohner, der im 19. Jahrhundert aus einem konfessionell geschlossenen Milieu in die Stadt zog, dort Protestanten, Juden und vielleicht ein paar Atheisten, so trifft der heutige Nachfahre jenes Dorfbewohners im 20. / 21. Jahrhundert potenziell auf eine viel kompliziertere Gemengelage: »Im Nebenhaus wohnt eine muslimische Familie, eine Verwandte ist Buddhistin geworden, Bekannte üben tägliche Meditation, der Lehrer der Kinder ist dezidierter Atheist und im Fernsehen und im Internet gibt es kaum irgendeine religiöse Tradition der Menschheitsgeschichte, die dort nicht vertreten ist« (BERGER 2000, 812). In diesem Kapitel versuchen wir, den empirisch angezeigten Wandel von Religion besser zu verstehen. Traditionellerweise hat die Religionspädagogik diesen Aspekt vor allem in Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Entwicklungspsychologie thematisiert: Es ging dann um den Wandel von Religion im Zuge der biografischen Entwicklung – ein Aspekt, der im nächsten Kapitel eingehend thematisiert wird (s. I.3). Allerdings greift dieser Zugang, sofern man sich auf ihn beschränkt, in einer Hinsicht zu kurz. Er übersieht, dass die Veränderungen in der Religiosität heutiger Kinder in den viel umfassenderen Gestaltwandel von Religion in der heutigen Gesellschaft eingelagert sind.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Religionsdidaktik Grundschule»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Religionsdidaktik Grundschule» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Religionsdidaktik Grundschule» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
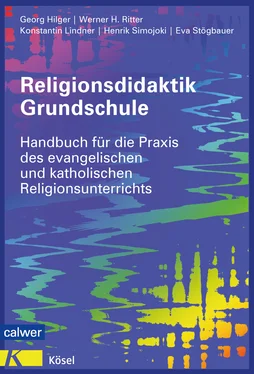
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)