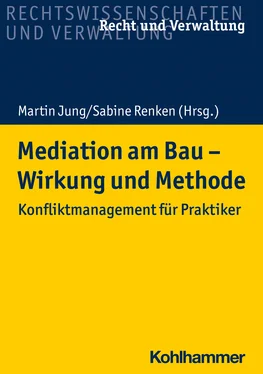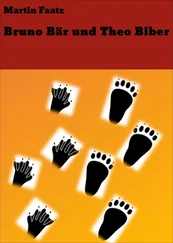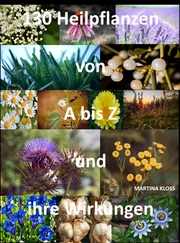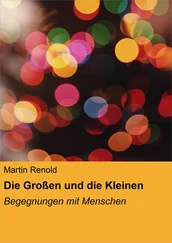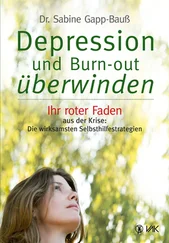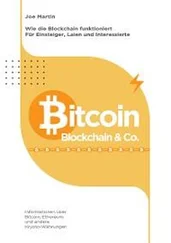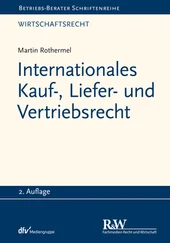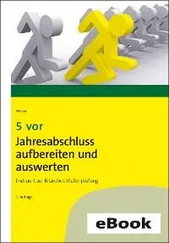27Kalte Konflikte sind eher unsichtbar und werden mit subtilen Mitteln der Sabotage, Blockade und Verzögerung geführt. Es sind Auseinandersetzungen, in denen es manchmal nur noch darum geht, der anderen Partei zu schaden. Oft sind kalte Konflikte das Ergebnis ehemals heißer Konflikte, die nicht gelöst werden konnten. Die Beteiligten sind daher frustriert und desillusioniert, was die Möglichkeit einer einvernehmlichen Lösung betrifft und verhalten sich entsprechend.
28Es gibt viele weitere Kategorisierungen von Konflikten und/oder der Teilnehmer an diesen. Interessant ist auch der Ansatz, die Parteien nach ihrem jeweiligen Konfliktverhalten zu typisieren und herauszufinden, wie sich das jeweils individuelle Verhalten im Konflikt auf eine Auseinandersetzung auswirkt – und wie man bzw. der Mediator am besten damit umgeht. Im Koordinatenkreuz zwischen Kooperationsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen lassen sich zwischen Kämpfen, Konkurrieren, Nachgeben und Vermeiden noch viele Schattierungen finden. Eine Darstellung aller dieser Ansätze würde den Rahmen unserer praktischen Einführung allerdings sprengen.
29Ein wichtiges Kriterium für die Mediation ist die „Freiwilligkeit“, sie ist auch im Mediationsgesetz postuliert. 10Die Parteien müssen dem Verfahren der Mediation zur Lösung ihres Konflikts zustimmen, sonst kann keine Mediation stattfinden. Freiwilligkeit ist schon deshalb eine unverzichtbare Voraussetzung für die Mediation, weil die Parteien selbst die Lösung ihres Konfliktes finden sollen, also einen selbstbestimmten Konsens erreichen müssen. Zwingen kann man sie dazu nicht.
30Die Freiwilligkeit ist aber auch gegeben, wenn die Mediation aufgrund einer vor Entstehung des Konfliktes geschlossenen Vereinbarung zustande kommt, was empfehlenswert ist und inzwischen auch immer häufiger praktiziert wird. 11Zunehmend enthalten auch Bauverträge Bestimmungen darüber, wie im Falle eines Konfliktes vorzugehen ist, und nicht selten ist Mediation hier das Mittel der Wahl. Verbindliche (schriftliche) Mediationsklauseln im Vertrag versperren den Parteien im Falle eines Konflikts zunächst den Gang vor das staatliche Gericht und „zwingen“ sie so, es zuerst mit einer Mediation zu versuchen. Zwar nehmen die Parteien dann zunächst unter einem gewissen äußeren Druck an dem Verfahren teil. Diesen haben sie jedoch mit Abschluss ihres Vertrages selbst erzeugt, und auch eine aus freiem Willen geschlossene Vereinbarung kann Pflichten auslösen. Es ist eine der Aufgaben des Mediators, die Teilnehmer an diesen ursprünglichen Konsens vor oder während des Verfahrens zu erinnern und sie dafür zu interessieren.
31Der Gedanke der Privatautonomie, der hinter der Forderung nach Freiwilligkeit steht und in unserem Rechtssystem Verfassungsrang hat, 12beinhaltet auch die Freiheit, sich nicht einigen zu müssen, das ist die andere Seite der Vertragsfreiheit. Diese inhaltliche Freiheit ist für die Mediation besonders wichtig, da ein Zwang zur Einigung dem Prinzip der Mediation diametral entgegensteht. Daher bedeutet das Prinzip der Freiwilligkeit auch, dass jede der Parteien die Mediation jederzeit beenden kann, und eben keine (vertragliche) Einigung zustande kommt.
In diesem Sinne muss die Freiwilligkeit also zu Beginn und bis zum Ende der Mediation gewährleistet sein.
4.Vertraulichkeit und Verschwiegenheitspflicht
32Eine weitere Bedingung für Mediation ist die Vertraulichkeit. Sie erlaubt der Mediation den geschützten Raum zu schaffen, der notwendig ist, damit sich die Parteien öffnen können, ohne befürchten zu müssen, dass ihre Äußerungen später gegen sie oder überhaupt öffentlich verwendet werden können. Ohne diesen angstfreien Raum ist es schwer bis unmöglich, die von den Positionen oft verdeckten eigentlichen Interessen offenzulegen und entsprechende Zugeständnisse zu machen.
33Vertraulichkeit ist einer der essentiellen Grundsätze für eine erfolgversprechende Mediation und auch ein zu recht viel gepriesener Vorteil des Verfahrens. Schließlich ist es in manchen Streitigkeiten durchaus von Vorteil, und zwar für alle Parteien, wenn die ihnen zugrunde liegenden Informationen nicht an die Öffentlichkeit gelangen. In einem staatlichen Gerichtsprozess ist das schon wegen des Prinzips der Öffentlichkeit mündlicher Verhandlungen nicht gewährleistet.
34Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird, postuliert der Vertraulichkeitsgrundsatz auch, dass die in der Mediation preisgegebenen Informationen nicht in einem späteren Gerichtsverfahren oder sonst zum Zwecke der Auseinandersetzung als Vorhalt oder Beweis verwertet werden dürfen. Dabei geht es nicht nur um den Schutz der Parteien, sondern wie gesagt auch um den der Mediation selbst.
35Nach dem Prinzip der Selbstbestimmtheit vereinbaren die Parteien einer Mediation die sie selbst betreffenden Verschwiegenheitspflichten sowie personen-, verfahrens- oder gegenstandsbezogene Verwertungsverbote und damit auch die Reichweite der Vertraulichkeit. Dabei sind sie aber an die Grenzen zwingenden Rechts gebunden, zu denen z. B. die gesetzlichen Aussagepflichten gehören. Nach der Zivilprozessordnung allerdings gibt es ein Zeugnisverweigerungsrecht für den Mediator. 13
36Aus dem Grundsatz der Vertraulichkeit ergibt sich die Verschwiegenheitspflicht, die in § 4 MediationsG festgeschrieben ist. Das heißt, ein Mediator darf die der Verschwiegenheitspflicht unterliegenden Informationen außerhalb der Mediation nicht offenbaren. Er muss grundsätzlich auch das für sich behalten, was eine der Parteien ihm in einem Einzelgespräch anvertraut hat. Die Verschwiegenheitspflicht bezieht sich auf alles, was dem Mediator in Ausübung seiner Tätigkeit als Mediator bekannt geworden ist, 14das gilt auch für eventuell vom Mediator in die Mediation eingebundenen Personen wie Schreibkräfte oder Co-Mediatoren.
37Die Parteien können mit dem Mediationsvertrag vereinbaren, dass auch sie sich Dritten gegenüber zur Vertraulichkeit verpflichten, und von dieser Möglichkeit wird in der Regel auch Gebrauch gemacht. Sie können sich gegenseitig oder den Mediator aber auch wieder von dieser Pflicht entbinden, zum Beispiel, wenn in einem der Mediation folgenden Gerichtsprozess Aufklärung über die in der Mediation besprochenen Tatsachen gesucht wird – ein eher seltener Fall. 15
38Ein Mediator kann eine sensible Wahrnehmung der einem Konflikt zugrunde liegenden Probleme anstoßen und die Parteien dazu bringen, über bisher nicht gesehene Lösungen nachzudenken. Mit entsprechender professioneller Kompetenz, menschlicher Integrität, auch interdisziplinärer Vernetzung und Felderfahrung (z. B. Branchenkenntnis) kann ein guter Mediator viel erreichen. Empathie, Achtsamkeit, Beweglichkeit, Interesse, Behutsamkeit, Verlässlichkeit und Sorgfalt im Umgang mit den Beteiligten sind außerdem wichtig, um bisher nicht wahrgenommene und nicht zum Ausdruck gekommene Gefühle und Werthaltungen sowie verworrene strukturelle Sachlagen zu durchschauen und aufzulösen. Das Wichtigste jedoch ist das Vertrauen der Parteien in den Mediator. Nur auf dieser Basis wird ein Transformationsprozess in Gang gebracht, der die Parteien zur Einigung führen kann.
39 a) Voraussetzungen, Ausbildung.Auch nach Inkrafttreten des Mediationsgesetzes im Jahr 2012 ist die Berufsbezeichnung „Mediator“ rechtlich nicht geschützt, im Prinzip kann sich also jeder Mediator nennen. Geschützt ist die Bezeichnung des „Zertifizierten Mediators“. So dürfen sich nach dem MediationsG nur Personen bezeichnen, die eine bestimmte Ausbildung abgeschlossen haben, Mediationserfahrung nachweisen können und spezifische Fortbildungspflichten erfüllen. Auch ein Rechtanwalt darf sich nur dann als Mediator bezeichnen, wenn er durch „geeignete Ausbildung nachweisen kann, dass er die Grundsätze des Mediationsverfahrens beherrscht“. 16Auch Steuerberater unterliegen als Mediatoren den Regeln ihres Berufsrechts.
Читать дальше