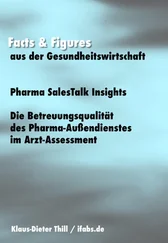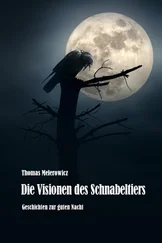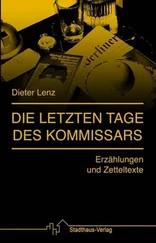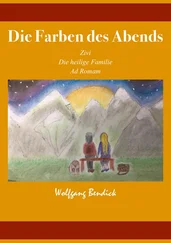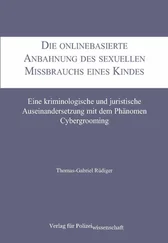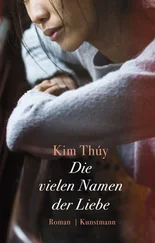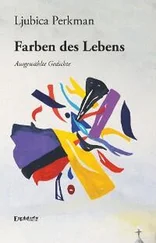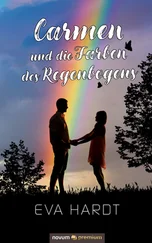Im 3. Kapitel wird näher auf die verschiedenen Aspekte von Abklärung und Diagnose eingegangen. Da der Begriff »Autismus« einem starken Wandel ausgesetzt war und immer noch ist, herrscht eine große Verunsicherung. Wie soll Autismus überhaupt diagnostiziert werden? Von wem? Wo soll man sinnvollerweise die Grenze zur sogenannten Normalität setzen? Diese und weitere Fragen werden von verschiedenen Fachleuten sehr unterschiedlich beantwortet. Für Betroffene und deren Eltern bedeutet dies, dass sie sich oft nicht auf die Meinung einer einzigen Fachperson bzw. Fachstelle stützen können und sollen. Und was die Sache noch schwieriger macht: Nicht selten haben sich Betroffene und Eltern anhand von Internet und Fachliteratur so viel Wissen angeeignet, dass sie besser über Autismus Bescheid wissen als die Fachperson, die ihnen gegenübersteht und eigentlich eine zuverlässige Beurteilung vornehmen müsste!
Autismus und Asperger-Syndrom verändern sich im Laufe eines Lebens erheblich. Deshalb wird im 4. Kapitel genauer beschrieben, wie sich diese Besonderheiten in einzelnen Lebensphasen auswirken und welches die für eine bestimmte Altersstufe typischen Probleme sind. Zur Veranschaulichung werden viele Fallbeispiele angeführt, die sich darüber hinaus im gesamten Buch finden.
Diagnosen werden oft als unnütze »Etiketten« und Stigmatisierungen bezeichnet. Dabei wird aber vergessen, dass eine Diagnose in allererster Linie zum Ziel hat, geeignete Handlungsstrategien zu entwerfen. Eine Diagnose soll also die Frage beantworten helfen, welches die für ein bestimmtes Problem bzw. Leiden richtige Hilfe ist. Diesem Thema, nämlich den im Einzelfall geeigneten Hilfen und Therapien, ist das 5. Kapitel gewidmet. So vielfältig das Autismus-Spektrum ist, so vielfältig und maßgeschneidert müssen auch die gewählten Therapien sein. Für Eltern ist es außerordentlich wichtig, hierüber gut informiert zu sein, denn sie entscheiden über allfällige Therapieangebote und: Sie stehen immer auch im Zentrum der therapeutischen Bemühungen. Man könnte zugespitzt sagen: Die wichtigsten »Therapeuten« für autistische Kinder sind deren Eltern.
Das 6. Kapitel behandelt die sogenannten Komorbiditäten. Damit ist gemeint, dass bei einem Kind zusätzlich zur Diagnose »Autismus-Spektrum-Störung« oft noch mindestens eine zweite Diagnose (= Komorbidität) hinzukommt. Kinder aus dem autistischen Spektrum leiden häufig unter Ängsten, Zwängen, Depressionen, Aufmerksamkeitsstörungen usw. Erst diese Folgestörungen, die aus dem Stress entstehen, dem die betroffenen Kinder täglich ausgesetzt sind, machen ja oft Therapien im engeren Sinne überhaupt erst notwendig. Und gleichzeitig sind es diese Folgestörungen, die die zugrundeliegende autistische Problematik verschleiern und eine richtige Diagnosestellung über längere Zeit erschweren können.
Wenn davon die Rede ist, dass autistische Kinder einem täglichen Stress ausgesetzt sind, dann ist die Hauptursache dieses Stresses meist die Schule bzw. unser Schulsystem. Dieses ist, und das kann man ihm ja nicht vorwerfen, auf das »normale«, durchschnittlich entwickelte Kind zugeschnitten. Das autistische Kind kommt mit dem vorherrschenden Schulsystem unweigerlich in Konflikt, und auf die vielfältigen Gründe dafür wird im 7. Kapitel eingegangen. Es werden aber auch hilfreiche Strategien und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Um ein so komplexes Thema wie jenes des Autismus zu erläutern, ist die Verwendung von vielen Fachausdrücken unvermeidlich. Damit das vorliegende Buch dennoch möglichst leserfreundlich gestaltet ist, wurde die Erläuterung von Fachausdrücken im Anhang in einem »ABC des Autismus« zusammengefasst.
Ebenfalls im Anhang findet sich eine Liste von nützlichen Informationen zu Vereinen und Selbsthilfegruppen, Internet-Foren sowie weiterführende Literatur.
In diesem Buch wird immer wieder folgende Feststellung auftauchen: Autismus ist keine Krankheit oder Behinderung, sondern eine Besonderheit bzw. ein Anderssein. Und dennoch werden im Zusammenhang mit dem Begriff Autismus auch Begrifflichkeiten wie »Störungsbild« oder »Störung« benutzt. Dies hat damit zu tun, dass die Besonderheit »Autismus« im Austausch mit der Gesellschaft und dem damit verbundenen Anpassungsdruck unweigerlich zu Stress bei den Betroffenen führt. Und dieser Stress führt unmittelbar zu unangemessenem Verhalten und längerfristig auch zu Zuständen mit Krankheitswert. Mit »Autistischer Störung« ist also sinngemäß der Folgezustand gemeint, der bei vielen Betroffenen – insbesondere solange sie unerkannt sind – zwangsläufig entsteht.
Aber worin besteht denn nun dieses autistische Anderssein und wie kommt es dazu? Die moderne wissenschaftliche Forschung, und insbesondere die moderne Hirnforschung mit ihren nichtinvasiven bildgebenden Verfahren, hat bereits viel zur Klärung dieser Fragen beitragen können. Vieles ist aber auch nach wie vor unklar.
Zunächst einmal ist aufgrund zahlreicher Forschungsergebnisse heute weitgehend unbestritten, dass die Vererbung beim Auftreten von Autismus eine entscheidende Rolle spielt (90 %). Dies zeigen sowohl unzählige Kranken- und Familiengeschichten, die Zwillingsforschung, und zunehmend auch Erkenntnisse aus der Genforschung selbst. Ebenso klar ist jedoch, dass die Vererbung nicht einfachen und überschaubaren Gesetzmäßigkeiten folgt und dass sie nicht auf irgendein einzelnes Gen oder einen ganz bestimmten Chromosomen-Defekt reduziert werden könnte. Es sind sicher eine ganze Reihe von Genen beteiligt und: das Vorhandensein dieser Gene bzw. Gendefekte heißt noch lange nicht, dass die betreffende Person dann auch zwingend von Autismus betroffen ist. Der sogenannte Genotyp (= die Summe der in den Genen verankerten Erbanlagen) führt nicht automatisch zu einem bestimmten Phänotyp (= die Summe der körperlichen und geistigen Eigenschaften eines Menschen). Die entsprechenden genetischen Befunde betreffen immer nur Wahrscheinlichkeiten. Vereinfacht gesagt: je größer die erbliche Belastung, umso wahrscheinlicher ist das Auftreten von Autismus, ohne dass man im Einzelfall eine Vorhersage machen kann.
In den Anfängen der Autismus-Forschung war allerdings eine andere Sichtweise vorherrschend! Im Gegensatz zu Hans Asperger, der seine Hypothese der Vererbung des Autismus sehr klar formulierte, aber leider, wie ja bereits erwähnt, lange gar nicht zur Kenntnis genommen wurde, nahm die von Leo Kanner in den USA ausgehende Entwicklung eine ganz andere Richtung. Sie gipfelte in den 1960er Jahren in der Theorie z. B. eines Bruno Bettelheim, die psychoanalytisch geprägt war und die die Ursache des kindlichen Autismus bei der »gefühlskalten« Mutter suchte! Mit dieser »psychologischen« Sichtweise wurde in der Vergangenheit großer Schaden angerichtet. Nicht nur, weil den betroffenen Müttern damit ein großes Unrecht angetan wurde (was hilfreichen Interventionen ganz sicher nicht förderlich ist!), sondern auch, weil Autismus rein defizitorientiert betrachtet wurde.
Die »genetische« Sichtweise hingegen, auch wenn das auf den ersten Blick paradox erscheint, kommt unweigerlich zum Schluss, dass die Veranlagung zu Autismus auch mit positiven Eigenschaften verbunden sein muss. Hans Asperger hat deutlich darauf hingewiesen, dass viele seiner Patienten, die er als Kinder kennengelernt hatte, später erfolgreiche Berufsleute wurden.
Im Übrigen zeigen Ergebnisse aus der neueren Evolutionsforschung, dass es sogar bei Tieren wichtige individuelle Unterschiede in jeder Tierart gibt und dass diese Individuen unterschiedliche Persönlichkeiten aufweisen. Was aber noch bedeutsamer ist: Eine Population von Tieren, bei welcher die individuellen Unterschiede zwischen den Mitgliedern größer bzw. ausgeprägter sind, hat bessere Überlebenschancen! Bisher wurde in der Evolutionsforschung immer nur darauf geachtet, welche Eigenschaften eines Individuums seine eigenen Überlebens- und damit auch Fortpflanzungschancen verbessern. Wenn man nun aber davon ausgeht, dass große interindividuelle Unterschiede in einer Population von Vorteil sind, dann heißt das, dass Menschen mit außergewöhnlichen (das heißt vom Durchschnitt abweichenden) Eigenschaften und Persönlichkeiten für die Gesamtgesellschaft von Nutzen sind. Und deshalb, das wäre eine sehr logische Schlussfolgerung, wurden in der Entwicklung der Menschheit Individuen, die eine Veranlagung für Autismus in sich tragen, von der Evolution nicht ausgeschieden. Sie wurden, weil sie neben ihren Defiziten im emotionalen und sozialen Bereich auch über besondere Fähigkeiten verfügten (z. B. Werkzeugbau), als nützliche Mitglieder der Gemeinschaft erkannt und mitgetragen.
Читать дальше