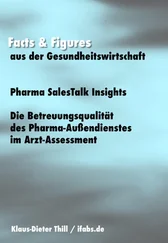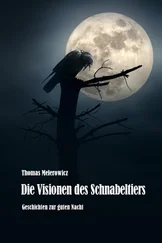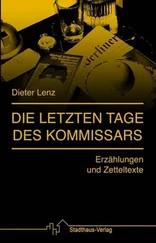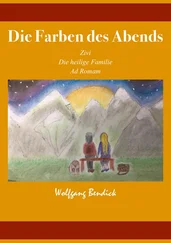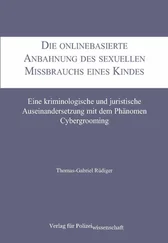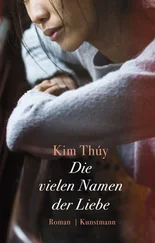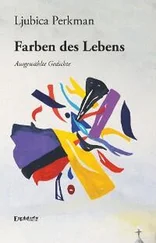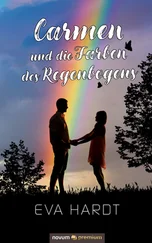Abgesehen von der Bedeutung der Vererbung gibt es aber auch viele Hinweise dafür, dass bei der Entstehung von Autismus eine gewisse vorbestehende Schädigung des Gehirns eine Rolle spielen kann. Diese Schädigung kann während der Schwangerschaft (Infektionskrankheiten der Mutter, Einfluss von Nikotin, Alkohol, Drogen und Medikamenten), bei der Geburt (Sauerstoffmangel) oder in der ganz frühen Kindheit erfolgt sein. Da Kinder mit Frühkindlichem Autismus öfter intellektuell beeinträchtigt sind als Kinder mit Asperger-Syndrom und auch öfter an zusätzlichen Zeichen von Hirnschädigung leiden (Epilepsie!), ist es sehr wahrscheinlich, dass der Faktor »leichte Hirnschädigung« bei der Entstehung des Frühkindlichen Autismus neben der Vererbung eine größere Rolle spielt als beim Asperger-Syndrom. Bei letzterem dürfte hingegen die Vererbung der überwiegende Faktor sein.
Oder anders formuliert: Den Faktor Vererbung haben alle Autismus-Spektrum-Störungen gemeinsam, aber je früher sich der Autismus in der kindlichen Entwicklung bemerkbar macht und je stärker beeinträchtigend er sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes auswirkt, desto eher ist neben der erblichen Veranlagung noch die zusätzliche Mitwirkung einer leichten Schädigung des Gehirns anzunehmen. Das entsprechende Störungsbild wäre dann der Frühkindliche Autismus.
Hier wird bewusst der Ausdruck »leichte Schädigung des Gehirns« benutzt. Damit soll ausgedrückt werden, dass sich diese Schädigung nur in geringem Maß auf die körperliche Entwicklung auswirkt und mit neurologischen Untersuchungsmethoden auch nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden kann. Wenn keine zusätzlichen Belastungsfaktoren vorhanden sind, dann kann eine solche leichte Schädigung auch völlig unbedeutend sein.
Wenn aber ein zusätzlicher Faktor wie die erbliche Veranlagung zu Autismus hinzukommt, dann kann dies große Bedeutung bekommen, nach dem Grundsatz: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das heißt, jeder Belastungsfaktor allein hätte keine gravierenden Folgen für die kindliche Entwicklung, beide zusammen aber sehr wohl.
Besonderheiten der autistischen Wahrnehmung
Spätestens bei der genaueren Betrachtung der Besonderheiten in der autistischen Wahrnehmung ist nun allerdings eine wichtige Zwischenbemerkung notwendig. Autismus wird mittlerweile v. a. deshalb nicht einfach als eine Krankheit oder eine Behinderung betrachtet (was Autismus zwar auch sein kann, aber nicht sein muss), weil die autistische Wahrnehmung nicht nur mit Nachteilen, sondern auch mit Vorteilen verbunden ist!
Mit Besonderheiten der autistischen Wahrnehmung sind im Einzelnen folgende Aspekte gemeint:
• Einzelheiten bzw. Details werden bevorzugt wahrgenommen, dies auf Kosten der Erfassung des Gesamtzusammenhangs, in welchem diese Einzelheiten stehen.
• Der Benutzung eines einzigen Sinneskanals (z. B. Hören oder Sehen) wird der Vorzug gegeben im Gegensatz zum gleichzeitigen Benutzen zweier oder mehrerer Kanäle (Hören und Sehen gleichzeitig).
• Ein bestimmter Sinneskanal wird generell bevorzugt (meist der visuelle) und andere stark vernachlässigt (z. B. der taktile).
• Bestimmte Sinnesqualitäten können überempfindlich sein (z. B. auf Lärm) und andere vermindert empfindlich (z. B. auf Kälte oder Schmerz).
• Der Wechsel von einem bestimmten Sinneskanal zu einem anderen ist nur erschwert oder verzögert möglich.
Der offensichtliche Nachteil der detailorientierten, eher eindimensionalen Wahrnehmung liegt im Vernachlässigen oder gar nicht Erkennen des Gesamtzusammenhangs sowie im Mangel an geistiger Flexibilität. Es gibt aber auch klare Vorteile: für bestimmte spezialisierte Tätigkeiten kann es sehr hilfreich sein, sich nicht von anderen Sinneseindrücken ablenken zu lassen und deshalb entscheidende Details zu erkennen, die andere übersehen würden.
Besonderheiten des autistischen Denkens
In Analogie zur autistischen Wahrnehmung neigt das autistische Denken zu Eindimensionalität:
• Konzentrierung auf eines oder auf ganz wenige Interessengebiete,
• mangelnde Flexibilität durch Verhaftetsein auf einen einmal eingeschlagenen Lösungsweg oder auf eine ganz bestimmte Erwartung,
• starke Bevorzugung des logisch-rationalen Denkens gegenüber dem ganzheitlich-intuitiven Denken,
• starke Einengung auf die eigene egozentrische Sichtweise und Vernachlässigen der Sichtweise der anderen.
Das autistische Denken führt dann im Weiteren zu Problemen mit der Zentralen Kohärenz ( 
Anhang
), zu Problemen bei den exekutiven Funktionen ( 
Anhang
) und bei der »Theory-of-mind« ( 
Anhang
) bzw. Empathie ( 
Anhang
). Zur Wahrung der Übersichtlichkeit sollen diese Begriffe hier nur erwähnt und im Anhang genauer erläutert werden. Jedenfalls passen diese Konzepte auf der Ebene des autistischen Denkens sehr gut zu den realen Problemen im Leben autistischer Menschen: Sie haben Probleme, komplexe sprachliche Botschaften zu verstehen (schwache Zentrale Kohärenz), sie haben Probleme, den Alltag in den Griff zu bekommen und Handlungen zielstrebig durchzuführen (beeinträchtigte exekutive Funktionen) und sie haben Probleme im zwischenmenschlichen Kontakt und Austausch (mangelnde Empathie bzw. Schwierigkeiten mit Theory-of-mind).
Das autistische Denken ist aber auf der anderen Seite von Vorteil, wenn es zum Beispiel darum geht, wissenschaftliche Forschung zu betreiben oder irgendeine sehr spezialisierte Tätigkeit auszuüben.
»In der ganz überwiegenden Zahl der Fälle kommt es nämlich zu einer guten Berufsleistung und damit zu einer sozialen Einordnung, oft in hochgestellten Berufen, oft in so hervorragender Weise, dass man zu der Anschauung kommen muss, niemand als gerade diese autistischen Menschen seien gerade zu solchen Leistungen befähigt« (Asperger 1944).
Besonderheiten des autistischen Fühlens
In den vorangehenden Abschnitten wurde darauf hingewiesen, dass autistisches Denken neben Nachteilen auch Vorteile mit sich bringt. Von den Besonderheiten des autistischen Fühlens (Umgang mit Emotionen) kann dies weniger behauptet werden.
Menschen aus dem Autismus-Spektrum sind meist einseitig auf das Denken und speziell das logisch-formale Denken ausgerichtet. Sie haben grundsätzlich Mühe mit ihren Emotionen wie auch mit den Emotionen der anderen.
Wenn man vom ganz kleinen Kind ausgeht, dann kann man feststellen, dass dieses noch keine differenzierten Emotionen empfinden und ausdrücken kann, sondern eher basale Zustände wie »Wohlsein« und »Unwohlsein«. Stark von Autismus Betroffene bleiben quasi auf dieser Entwicklungsstufe stehen. Im Falle von »Unwohlsein« bzw. bei negativen Emotionen können sie nicht unterscheiden, ob sie nun Wut, Enttäuschung, Trauer oder eine andere negative Emotion empfinden. Entsprechend können sie diese Emotionen auch nicht differenziert ausdrücken oder mitteilen.
Weniger stark Betroffene entwickeln zwar zumindest eine Differenzierung der basalen Emotionen wie Trauer, Freude, Wut, Überraschung usw. Dennoch haben sie große Mühe, wenn es darum geht, diese Emotionen bei sich selbst zu erkennen, sie angemessen auszudrücken oder gar anderen differenziert mitzuteilen.
Читать дальше