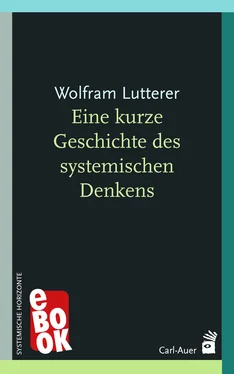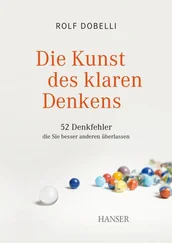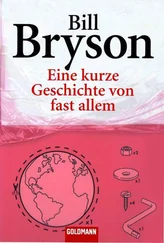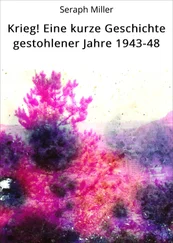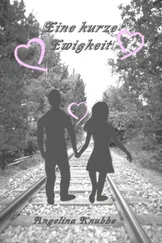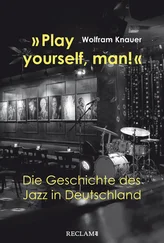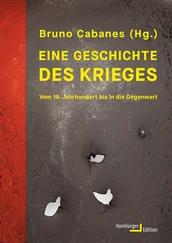»Es entsteht aufgrund von Unwissen Gestalten, aufgrund des Gestaltens Bewusstsein, aufgrund von Bewusstsein Körper und Geist, aufgrund von Körper und Geist die sechsfache (Sinnen-)Grundlage, aufgrund sechsfacher (Sinnen-)Grundlagen Berührungen, aufgrund von Berührungen Gefühl, aufgrund von Gefühl Verlangen, aufgrund von Verlangen Anhaften, aufgrund von Anhaften Werden, aufgrund von Werden Geburt, aufgrund von Geburt Alter, Tod, Kummer, Sorge, Leid, Trübsinn und Verzweiflung. Auf diese Weise entsteht die Gesamtheit von Unzulänglichkeiten. Durch völlige Aufgabe und Auflösung von Unwissenheit löst sich Gestalten auf, durch Auflösung …« 6
Diese zwölfgliedrige Kette folgt auf den ersten Blick vielleicht zwar nicht unbedingt unserem typischen kausal orientierten Verstehen und Verketten von derartigen Prozessen und Phänomenen; als eine bloße »Kette« verstanden wäre sie zudem natürlich kein Zeichen für ein frühes systemisches Denken. Aber es lohnt sich vielleicht, kurz innezuhalten und jenes »vorwärts und rückwärts« zu Denkende ernst zu nehmen. So führt ja Werden beispielsweise zu Geburt, aber genau umgekehrt wiederum Geburt zum Werden. Zudem entsteht Gefühl nicht nur durch Berührungen, sondern auch aufgrund von Verlangen – und dann vielleicht wiederum als Gefühl zu Berührungen.
Es lässt sich somit mit all diesen Kettengliedern hin und her spielen und sich hierbei vergegenwärtigen, wie sehr diese Glieder miteinander verbunden sind. Dies zumindest sollte Grund genug dafür sein, Siddharta in die Reihe systemischer Vor-Denker einzureihen.
Ein weiterer prominenter Vordenker entstammt dem chinesischen Kulturkreis. Von dem Philosophen Laozi *(auch: »Laotse«) sind zwar keine genaueren Lebensdaten bekannt, er soll jedoch ebenfalls im 6. Jahrhundert v. Chr. gelebt haben. Genaueres weiß man allerdings nicht. Vielleicht hat er sogar erst im 3. Jahrhundert gelebt. Nimmt man den früheren Termin, so können wir ihn uns jedenfalls als einen ungefähren Zeitgenossen von Xenophanes und Siddhartha Gautama Buddha vorstellen.
Gelebt haben soll Laozi in einem Landstrich, der heute zu der chinesischen Provinz Henan gehört. Laozi gilt als der Begründer des Taoismus. Und im Gegensatz zu Buddha ist immerhin eine Schrift überliefert, die ihm zugerechnet wird, das Daodejing – bzw. in anderer Schreibweise Tao-te-king .
Im Daodejing zeigt Laozi mithilfe verschiedenster Beispiele, ganz ähnlich wie Siddharta, die wechselseitige Bedingtheit von Phänomenen auf. Schon zu Beginn formuliert er:
»Wenn auf Erden alle das Schöne als schön erkennen,
so ist dadurch schon das Hässliche gesetzt.
Wenn auf Erden alle das Gute als gut erkennen,
so ist dadurch schon das Nichtgute gesetzt.
Denn Sein und Nichtsein erzeugen einander« (Laotse 1978, S. 42). 7
Damit nimmt er eine sichtbar relativistische Perspektive ein. Es gibt eine grundsätzliche Verbundenheit von eigentlich als komplementär erachteten Dingen. Es kann nicht einfach alles nur – so wie in manchen Kindheitsträumen vielleicht – gut und schön sein. Vielmehr sind dies jeweils notwendigerweise Gegensatzpaare. Nichts Schönes ohne das Hässliche, so einfach ist das.
Laozi formuliert darüber hinaus eine kritische und wiederum relativistische Feststellung, was das Wissen selbst anbelangt: »Die Nichtwissenheit wissen ist das Höchste« (ebd., S. 114). Ähnliches wird später Sokrates formulieren. Alles in allem offenbaren sich damit bei Laozi deutliche prä-konstruktivistische sowie systemische Gedanken.
Im europäisch geprägten Kulturraum sind Buddha und Laozi vor allem seit dem 19. Jahrhundert breiter rezipiert worden. In inhaltlicher Hinsicht unterscheiden sich ihre frühen Gedanken jedenfalls nicht sehr von dem, was zur gleichen Zeit auch in unserem Kulturkreis anzutreffen ist: An sehr unterschiedlichen Orten finden sich Spuren und frühe Einsichten in die systemisch-konstruktivistische Struktur unserer Welt. Damit nun wieder zurück zu den Griechen.
Heraklit (ca. 520–460 v. Chr.) ist ein weiterer der frühen, vorsokratischen griechischen Philosophen. Von ihm werden eine Reihe von auf den ersten Blick reichlich merkwürdig anmutender Sprüche überliefert.
Berühmt geworden ist seine Behauptung: »Es ist unmöglich, zweimal in denselben Fluss hineinzusteigen.« 8Warum? Beim nächsten Mal ist der Fluss bereits ein anderer, es fließt anderes Wasser durch ein anderes Flussbett. Heraklit verdeutlicht damit, dass alles in Veränderung befindlich ist. Daraus aber, so könnten wir folgern, sind auch unsere Beobachtungen als zeitgebunden anzusehen und deshalb nicht als absolut zu setzen. Gelebt hat Heraklit in Ephesos, an der Westküste der heutigen Türkei gelegen.
Heraklit belässt es jedoch nicht bei dieser bloßen und vielleicht sogar etwas banalen Beobachtung, dass sich unsere Umwelt in stetiger Veränderung befindet. Sein Argument geht einen wesentlichen Schritt weiter: »In dieselben Flüsse steigen wir und steigen wir nicht, wir sind, und wir sind nicht.« Für Heraklit ist somit das Werden, die Veränderung, eine ganz zentrale philosophische Frage.
Ein menschliches Sein im Sinne eines fixen inneren Zustands ist in dieser Perspektive eine Fiktion. Wir selbst befinden uns ebenfalls in stetiger Veränderung, sind uns niemals gleich. Es ist nicht nur der Fluss, der sich ständig verändert, wir selbst verändern uns ebenfalls.
Heinz von Foerster hat diese Aussage später übrigens nochmals weiter verdichtet: »Man kann nicht einmal einmal in denselben Fluss steigen.« 9Denn schon das Hineinsteigen selbst benötigt Zeit. Aber mehr noch, das Hineinsteigen verändert seinerseits sowohl den Fluss als auch uns selbst. So verändert sich die Temperatur unserer Haut im Kontakt mit dem Wasser, ebenso wie das Wasser rund um unsere Haut sich ein wenig erwärmt; vielleicht werden unsere Füße nass. Aber nicht zuletzt verändert sich unsere Perspektive von »außerhalb des Flusses« auf »im Fluss«, und es vergeht Zeit: Erfahrungszeit, Lebenszeit.
Doch mit Beobachtungen wie diesen wären wir bereits inmitten dessen, was später durch von Foerster als »Kybernetik zweiter Ordnung« bezeichnet wird, und somit in Diskussionen, die erst rund 2500 Jahre später erfolgen … und mittendrin im systemischen Denken.
Das menschliche Maß (Protagoras)
Protagoras (ca. 490–411 v. Chr.), der letzte des hier vorgestellten Trios früher griechischer Philosophen, war bereits ein Zeitgenosse dessen, der uns heute als Inbegriff des Philosophen schlechthin gilt: Sokrates. Im Gegensatz zu Sokrates jedoch, dessen Lebensdaten man recht genau kennt, wissen wir von Protagoras einmal mehr nur ungefähr, wann er gelebt hat. Mit Protagoras rücken wir endlich zudem näher an den zentralen Ort der griechischen Philosophie: Athen. Geboren in Abdera, ganz im Nordosten des heutigen Griechenlands, soll er einen großen Teil seines Lebens in Athen verbracht haben.
Protagoras folgt zunächst Annahmen, die bereits Xenophanes entwickelt hat. Dann geht er jedoch ein wesentliches Stück weiter. Für Protagoras ist nämlich der Mensch das »Maß aller Dinge«. 10Was meint das? Auf einen ersten Blick könnte man meinen, Protagoras plädiert für eine entschieden anthropozentrische Weltsicht im Sinne dessen, dass eben wir im Mittelpunkt der Welt stünden und dass das von uns angelegte Maß somit für alles und jedes gültig sei, also ganz anders als das eher krude wirkende »Macht euch die Erde untertan!« der biblischen Schöpfungsgeschichte.
Aber ganz so einfach ist es bei Protagoras nicht. Weitere überlieferte Fragmente seines Denkens klären hierzu weiter auf. Er erweist sich hierbei nämlich als ein entschieden reflexiver Denker, was sich insbesondere in seinem Verständnis wiederum von der Idee der Wahrheit offenbart. Versuchte Xenophanes noch, »Wahrheit« auf bloße »Annahme« zu reduzieren, argumentiert Protagoras durchaus moderner, dass »Wahrheit Relationalität« sei. Damit aber entwickelt er eine bereits dezidiert systemische Perspektive: Die Vorstellung einer Wahrheit steht bei ihm in Relation zu einem Beobachter. Als Grund für diese Position führt Protagoras genau dies auch an: »[…] weil jedes Erscheinende oder Vermeinte auf jenen hin (dem es erscheint oder deucht) vorliege.« 11
Читать дальше