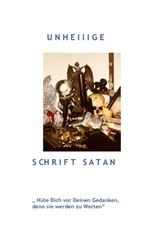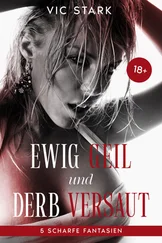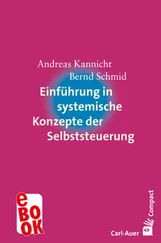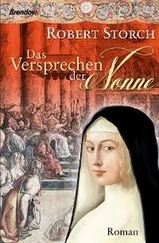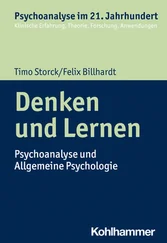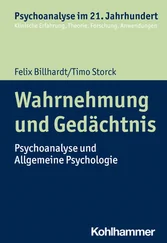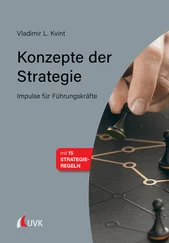Hier allerdings die Psychoanalyse der Hermeneutik schlicht entgegenzustellen, greift zu kurz, denn es übersieht Positionen innerhalb der philosophischen Hermeneutik, von der die Psychoanalyse profitieren kann. Zunächst einmal liefert das »kanonische« Werk der philosophischen Hermeneutik des 20. Jahrhunderts, Gadamers (1960) Wahrheit und Methode, Anknüpfungspunkte, etwa wenn es darin heißt, dass Verstehen immer ein Andersverstehen sei, was neben der Kontextualität auch die Perspektivität des Verstehens unterstreicht. »[I]n jedem Augenblick, d. h. in jeder konkreten Situation« müsse »neu und anders verstanden werden« (a. a. O., S. 292). Ebenso wie Jaspers auf die Grenze des Verstehens hinweist, entwickelt Angehrn (2010) in umfassender Weise eine Art von Taxonomie des Nicht-Verstehens, indem er die Grenzen des Sinnverstehens diskutiert.
Der Gedanke des Negativen in der Hermeneutik wird psychoanalytisch von Küchenhoff & Warsitz (2017) aufgenommen, die betonen, dass psychoanalytisches Verstehen im Wesentlichen darin besteht, den Spuren des Abwesenden nachzugehen, also das zu verstehen, was in der Rede umkreist und nicht gesagt wird, sich aber gerade darin einem möglichen Zugang zeigt. Das Subjekt artikuliert sich nur »über den Selbstentzug der Worte, in denen es sich auszudrücken versucht« (a. a. O., S. 206). Ähnlich heißt es bei Lacan (1955/56, S. 137): »Der Zustand der Sprache zeichnet sich ebensowohl durch das, was in ihr abwesend ist wie durch das, was in ihr anwesend ist, aus.«
Das kann dazu führen, für psychoanalytisches Verstehen methodologisch (und klinisch) ein Zusammenwirken von Verstehen und Nicht-Verstehen in einer negativen Hermeneutik zu formulieren (Storck 2016). Methodologisch würde es zum einen um die Grenzen des Verstehens gehen, dann um das Entzogensein des zu verstehenden Sinns und schließlich um die Differenz derjenigen, die in der Analyse etwas verstehen wollen. Klinisch geht es um die Beachtung des Nicht-Verstehens oder Missverstehens, welches die Grundlage dafür liefert, über das wechselseitige Andersverstehen zu einem Veränderungsprozess zu gelangen, in dem eine Analysandin in ihrem Erleben die Möglichkeit erwirbt, alternative Formen des Selbstverstehens zu erlangen als die im Symptom erstarrten.
Der nächste Kritikpunkt Jaspers’ gegenüber der Psychoanalyse richtet sich darauf, dass Freud meint, durch Verstehen zu einer Theorie gelangen zu können. Er habe unrichtigerweise angenommen, »daß alles im Seelenleben […] verständlich (sinnvolldeterminiert)« sei (allerdings auf »als-ob«-hafte Weise), und noch dazu »aus verständlichen Zusammenhängen Theorien über die Ursachen des gesamten seelischen Ablaufs« gemacht, »während Verstehen seinem Wesen nach nie zu Theorien führen kann« (a. a. O., S. 452). In der Psychoanalyse würden daher aus Sicht Jaspers’ »verständliche Zusammenhänge mit kausalen Erklärungen verwechselt«, wenn »aus verständlichen Zusammenhängen Theorien konstruiert« würden (Jäger 2016, S. 37; vgl. Heinz 2002, S. 40; Bormuth 2018, S. 54ff.). Auch die Kritik Grünbaums (1984) hebt Freuds Verwechslung von Verstehen und Kausalität hervor, vor allem demonstriert an der vermeintlichen Verbindung zwischen Paranoia und verdrängter Homosexualität (  Kap. 3.1.2).
Kap. 3.1.2).
Freud ging es immer wieder um eine Abgrenzung von ihm als spekulativ erscheinender Philosophie. Stattdessen versuchte er, die Psychoanalyse und ihre Erkenntnisse sprachlich (und professionspolitisch) in die Nähe von Naturwissenschaftlichkeit zu bringen. Habermas (1968, S. 301) hat das als »szientistisches Selbstmissverständnis« bezeichnet. Das Ringen zwischen der Novellenartigkeit der Falldarstellungen (Freud 1895d, S. 227), dem klinisch-verstehenden Vorgehen und dem Anspruch auf Naturwissenschaftlichkeit hat Freud selbst nicht in einer erkenntnistheoretisch schlüssigen Sicht auf die Psychoanalyse auflösen können. Andere haben später das Zusammenwirken von »Kraft« und »Sinn« oder von »Verstehen« und »Erklären« unterstrichen (Ricœur 1965; Lorenzer 1986; Warsitz 1997).
Nimmt man die methodischen und methodologischen Bemerkungen ernst, dann gewinnt die Analytikerin Erkenntnisse durch ein reflektierendes In-Beziehung-Stehen zur Analysandin. Die Erkenntnismethode ist dabei angewiesen auf die relationale Beziehungserfahrung – die Psychoanalyse nimmt also den Ausgang vom Einzelfall einer Beziehung. Darin findet das Verstehen im oben beschriebenen Sinn statt, aber es geschieht noch mehr: Es wird auf Konzepte rekurriert (und diese gelegentlich modifiziert), um Phänomene im Zusammenhang des Einzelfalls begreiflich zu machen. Das findet sich in der Freud’schen Theoriebildung, etwa zur unbewussten Fantasie oder zur Übertragung, beides sind ja konzeptbildende Antworten auf Vorgänge in einzelnen Behandlungen gewesen. Es geschieht keine Verallgemeinerung oder Prognose für viele andere genügend ähnliche Fälle, sondern die Verallgemeinerung liegt auf der Ebene der Konzeptbildung. Es wird nicht, um eine Formulierung Zepfs (Zepf 2006, S. 263) aufzugreifen, theoretisch gesagt, wie Behandlungen (und Erkrankungen) allgemein verlaufen, sondern es wird theoretisch allgemein gesagt, wie besondere Behandlungen (und Erkrankungen) verlaufen. Es wird dabei also ein klinisches Phänomen methodisch geleitet auf den Begriff gebracht. Zum Verstehen tritt ein Begreifen hinzu (Zepf & S. Hartmann 1989), und auf diese Weise geschieht eine Art von Modellbildung, die dabei helfen kann, weitere Einzelfälle und die Phänomene darin zu verstehen.
Der 17-jährige A. wird auf die geschlossene Station einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen, nachdem er in der Innenstadt Passanten scheinbar grundlos angegriffen hat. Er ist voller Überzeugung, diese hätten schlecht über ihn gesprochen. Auch den hinzugerufenen Polizisten gegenüber sei er sehr provokant aufgetreten. Im Aufnahmegespräch zeigen sich bei ihm eine deutlich eingeschränkte Auffassung sowie stark eingeschränkte mnestische und Aufmerksamkeitsfunktionen. Sein formales Denken ist in Form von Verlangsamung, Umständlichkeit, Weitschweifigkeit, Neologismen und Inkohärenzen stark beeinträchtigt. A. ist im Affekt gereizt-disphor sowie wiederholt parathym. Seine Mimik ist verflacht, seine Körperhaltung wirkt bizarr und manieristisch, insgesamt ist er psychomotorisch verlangsamt. Er berichtet von Größenideen: »Ich bin der Auserwählte. Auf der Straße erkennen manche mich.« A. meint, von den Ärzten würden Informationen über ihn an die Polizei weitergegeben, und er deutet Gesten und Bewegungen der Behandelnden als »Zeichen« für ihn. Aussagen von Mitpatienten erlebt er bezogen auf sich bzw. seine Biografie.
Während der ersten Tage und Wochen entsteht der Eindruck von Ich-Störungen in Form von Gedankeneingebungen. A. meint, er könne andere Personen durch seine eigenen Gedanken beeinflussen und steuern, beispielsweise zu vereinbarten Treffpunkten bewegen. Ebenso kristallisiert sich deutlich ein ausgeprägtes, systematisiertes und nicht korrigierbares Wahnerleben heraus: A. meint, er sei ein respektiertes Mitglied eines Geheimbundes, dessen Handzeichen eines dauerhaft gebeugten Ringfingers als Zeichen von Loyalität und Zugehörigkeit gilt. Sein Geheimbund rivalisiert mit anderen Organisationen und hat Deutschland in verschiedene Territorien aufgeteilt.
Mit seinem muskulösen Körperbau, seiner hohen Anspannung, seinem paranoid wirkenden und starren Blick sowie einem häufig parathym erscheinenden Grinsen erscheint A. seinem Behandler unberechenbar und löst in der Gegenübertragung Angst aus sowie die Fantasie, von ihm spontan physisch angegriffen zu werden. Dies weitet sich aus zur Fantasie, A. könnte ihn nach Entlassung aufsuchen und bedrohen. Nach einiger Zeit der Behandlung findet sich bei A. eine aus einer Zahnbürste gebaute Stichwaffe.
Читать дальше
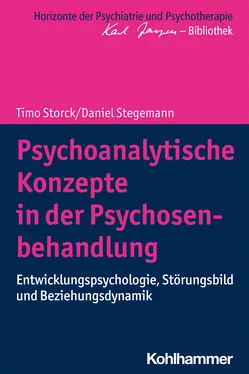
 Kap. 3.1.2).
Kap. 3.1.2).