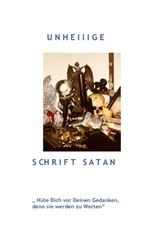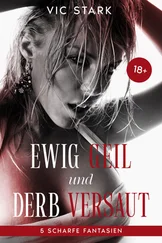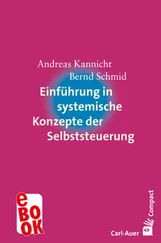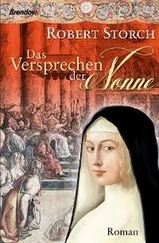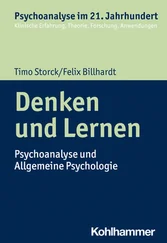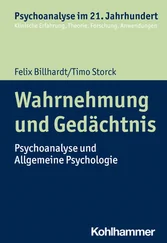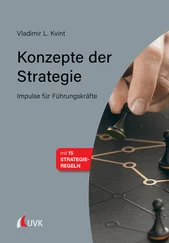Die psychoanalytische Theorie erschöpft sich nicht in der Konzeption motivationaler Konflikte, sondern schließt auch repräsentationale ein (Storck 2021a). Es können nicht nur Lust und Unlust oder widerstreitende Affekte miteinander in Konflikt stehen, sondern auch verschiedene Aspekte des Erlebens von Selbst und anderen. In der Psychoanalyse taucht die psychische Repräsentanz anderer als »Objekt« auf. Damit ist keine Vergegenständlichung gemeint, sondern der Terminus entsteht aus der Triebtheorie, in welcher das (Trieb-)Objekt als »das variabelste am Triebe« (Freud 1915c, S. 215) auftaucht, als das am stärksten von der Erfahrung abhängige an ihm. Die andere der Interaktion ist selbst im Triebkonzept immer mitgedacht, ebenso wie in der psychoanalytischen Theorie der Sexualität. Dezidiert taucht hier in der Psychoanalyse ein erweiterter Begriff von Sexualität auf (Freud 1905d, S. 35): Sexualität meint dabei die Empfindung von Lust bzw. Befriedigung auf der Grundlage der Körperlichkeit. Dann ist folgerichtig von einer infantilen Sexualität zu sprechen und das Verständnis von Sexualität über den Bereich des Genitalen hinaus auszudehnen. Vor diesem Hintergrund steht die Theorie der psychosexuellen Entwicklungsphasen. Wie unten (  Kap. 2.1.2) genauer ausgeführt werden wird, beginnen diese nicht erst mit der oralen Phase, sondern mit begrifflich bei Freud ungenau gefassten Phasen von Autoerotismus und (primärem) Narzissmus (z. B. Freud 1914c, S. 142).
Kap. 2.1.2) genauer ausgeführt werden wird, beginnen diese nicht erst mit der oralen Phase, sondern mit begrifflich bei Freud ungenau gefassten Phasen von Autoerotismus und (primärem) Narzissmus (z. B. Freud 1914c, S. 142).
In psychoanalytischer Betrachtung haben ödipale Konflikte eine wesentliche Funktion für die Entwicklung und Struktur des Psychischen. Für Freud (z. B. 1916/17, S. 342ff.) geht es dabei im Wesentlichen um die ins 5./6. Lebensjahr verortete Rivalität mit dem einen Elternteil um die Nähe zum anderen. Das wird gemäß der erweiterten Konzeption als sexuell bezeichnet, meint aber nur in seinen Abweichungen den Wunsch nach genitaler Sexualität. Freud beschreibt die Konstellation für Mädchen und Jungen bezüglich Vater und Mutter in allen Konstellationen (also auch die Wünsche des Jungen nach Nähe zum Vater und Rivalität mit der Mutter), allerdings findet es sich für den Jungen und dann in seiner »positiven« Form (also Rivalität mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil um die Nähe zum gegengeschlechtlichen) deutlicher ausformuliert. Es geht dem Jungen darum, den Vater als Rivalen an der Seite der Mutter zu beseitigen. Konflikthaft ist das zum einen aufgrund der Straferwartung durch den Vater, zum anderen aufgrund der Tatsache, dass der erfüllte Wunsch, der Vater möge »weg« und beseitigt sein, eben nicht nur lustvoll ist, sondern auch schmerzhaft: Würde der Vater tatsächlich von der Bildfläche verschwinden, wäre es ein Verlust – der geliebte Vater wäre verloren und dies auch als jemand, der die Nähe zur Mutter zu regulieren helfen könnte. Darin besteht der eigentliche ödipale Konflikt im Psychischen. Die Erfüllung der lustvollen Wünsche gegenüber der Mutter und der aggressiven gegenüber dem Vater würde Unlust nach sich ziehen: Angst vor unregulierter Nähe zur Mutter, Schuldgefühle und Straferwartung angesichts der Aggression und Schmerz/Trauer angesichts des verlorenen, ebenfalls geliebten und ersehnten Vaters. Die Lösung im Freud’schen Sinn (1924d) besteht in der Identifizierung: So zu sein wie der Rivale kann heißen, dass jemand einen selbst einmal so lieben wird wie die Mutter den Vater liebt. Da ödipale Wünsche und Konflikte in verschiedenen Konstellationen auftauchen, geht es ebenso um Identifizierungen mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil.
Es liegt auf der Hand, dass ein Erleben und Empfinden in Dreier-Konstellationen nicht erst im 5. Lebensjahr beginnt. Klein (1928) beschreibt »Frühstadien des Ödipuskonfliktes«, und in einer solchen Sicht geht es bereits in den ersten Stadien der psychischen Entwicklung darum, dass Zustände von Frustration oder von passagerer Abwesenheit einer Bezugsperson eingebettet sind in ein Beziehungsangebot von mehr als einer Person. Exploration als die relative Entfernung von einer Bezugsperson ist dann möglich, wenn
• diese einen »sicheren Hafen« bereitstellt, zu dem man zurückkehren kann und
• das Sich-Entfernen von ihr bedeuten kann, zu jemand anderem in Beziehung zu treten.
Dabei ist entscheidend, die Erfahrung zu machen, dass die Personen, zu denen jemand in Beziehung steht, auch zueinander in Beziehung stehen (z. B. bei Green 1975). Das wäre eine zeitgenössische Lesart der Freud’schen Rede von der Urszene. Während diese bei Freud (z. B. 1900a, S. 590f.) noch sehr konkret darauf bezogen ist, dass das Kind Mutter und Vater beim Geschlechtsverkehr sieht, ist das Wesentliche darin, dass Mutter und Vater »hinter verschlossener Tür« etwas miteinander teilen, von dem das Kind passager ausgeschlossen ist (so z. B. bei Britton 1998, S. 157ff.). Dann ist es ein Sinnbild dafür, in der Welt nicht nur andere, sondern auch deren Beziehungen zueinander zu finden. Auf diese Weise lassen sich ödipale Konflikte allgemein auf die Auseinandersetzung mit Generationen- und Geschlechtsunterschieden beziehen sowie auf die Auseinandersetzung damit, dass es in der Welt Beziehungen gibt, die andere miteinander haben, also ein Beziehungsgeflecht, anstatt dass alle Beziehungen ausschließlich von einem selbst wie in einem Sonnensystem »wegstrahlen«. In dieser Betrachtungsweise werden ödipale Konflikte auch maßgeblich für Kinder, die bei gleichgeschlechtlichen Eltern oder mit einem alleinerziehenden Elternteil aufwachsen, denn auch dann wird das Kind mit der Erfahrung konfrontiert sein, dass eine Bezugsperson noch auf etwas oder jemand anderes bezogen ist.
2.1.2 Die psychoanalytische Entwicklungstheorie im Hinblick auf Körperlichkeit, Denken und Fühlen
Im Weiteren stellen wir die psychoanalytische Entwicklungstheorie im Hinblick auf Körperlichkeit, Denken und Fühlen dar. Diese drei Bereiche werden die Grundlage dafür liefern, im Kapitel 3 die Konzeptualisierungen psychotischer Störungen einordnen zu können.
Am Beginn der psychischen Entwicklung steht auch aus Sicht der Psychoanalyse die sinnlich-körperliche Interaktion mit anderen, mit Merleau-Pontys (1964) Ausdruck: »zwischenleiblich«. Dabei ist es der Wechsel von Berührung und Nicht-Berührung, eingebettet in eine Erlebnisszene von Geruch, Stimme, Bewegung u. a., durch die und mit der Bezugsperson, der erste Erfahrung von »Kontakt an einer Grenze« mit sich bringt. Wenn Freud (1923b, S. 253) schreibt, das »Ich« sei »vor allem ein körperliches« bzw. die »Projektion einer Oberfläche«, dann verweist das darauf, dass sich die innere Repräsentation einer Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst zunächst bezüglich des Verhältnisses zwischen Körper und Umwelt zeigt.
Bei Freud findet sich der Ausdruck »Ich« in wechselnder Bedeutung, mal in der hemmenden Wirkung des Ichs auf primärprozesshafte Erregungsabläufe (z. B. Freud 1950a, S. 417), mal als das, worauf sich die Libido nach dem Abzug von den Objekten richtet (»narzisstische« bzw. Ich-Libido) (Freud 1917e) und mal als eine der Instanzen des Psychischen, die sich über ihre Funktionen (die Ich-Funktionen) bestimmt (Freud 1923b). Nach Vorschlägen H. Hartmanns (1956, S. 278) wird vom Ich als einer Organisation im Psychischen gesprochen, die durch bestimmte Funktionen gekennzeichnet ist, z. B. Realitätsprüfung, Kontrolle der Motorik u. a., während »Selbst« die psychische Repräsentanz der eigenen Person meint.
Freuds Rede vom Ich als einem körperlichen wäre daher im Grunde umzuformulieren zu: Das Selbst ist vor allem ein zwischenleibliches. Es bleibt aber der Gedanke bestehen, dass es die körperbezogene Erfahrung von Berührung als Kontakt an einer Grenze ist, welche die beginnende Repräsentation eines In-Beziehung-Stehens möglich macht, denn nur die basale Repräsentation einer Grenze kann es ja erst mit sich bringen, sich und jemand anderen als bezogen aufeinander, als in einer Beziehung stehend, zu erleben. Das ist keine momenthafte, punktuelle Erfahrung, sondern das Resultat eines Prozesses bzw. eines »Eingespieltseins« von Kind und Bezugspersonen in der frühen Entwicklung. So wird bei förderlichen Entwicklungsbedingungen eine Körperkontur internalisiert.
Читать дальше
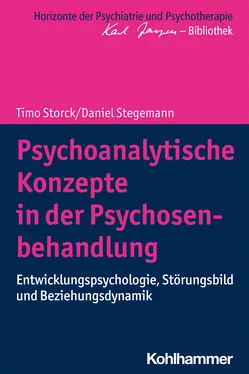
 Kap. 2.1.2) genauer ausgeführt werden wird, beginnen diese nicht erst mit der oralen Phase, sondern mit begrifflich bei Freud ungenau gefassten Phasen von Autoerotismus und (primärem) Narzissmus (z. B. Freud 1914c, S. 142).
Kap. 2.1.2) genauer ausgeführt werden wird, beginnen diese nicht erst mit der oralen Phase, sondern mit begrifflich bei Freud ungenau gefassten Phasen von Autoerotismus und (primärem) Narzissmus (z. B. Freud 1914c, S. 142).