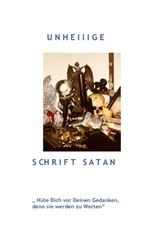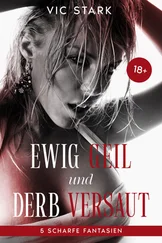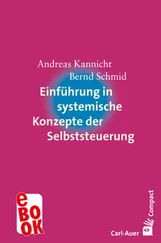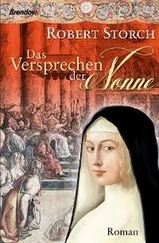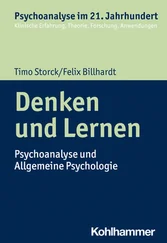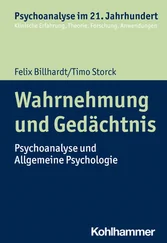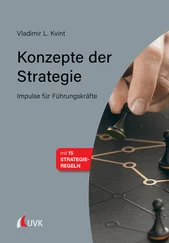Im vorliegenden Band geht es um die Erörterung psychoanalytischer Konzepte für ein Verständnis psychotischer Störungen und deren Behandlung, in erster Linie der Schizophrenie. Anthropologische oder phänomenologische Psychiatrie oder »klassische« Psychopathologie (vgl. Jäger 2016) auf der einen, Psychoanalyse auf der anderen Seite haben einander viel zu sagen. Der programmatische Ausdruck Blankenburgs (1971) zur Schizophrenie als eines »Verlusts der natürlichen Selbstverständlichkeit« kann das aufzeigen, geht es doch auch der Psychoanalyse um einen Blick auf den Zugang des Individuums zu sich selbst, mit samt aller Fallstricke, die dort zu finden sind. Aber es geht auch der Psychoanalyse darum, dass der Mensch gleichsam dazu prädisponiert ist, sich selbst zu verstehen – mit allen Grenzen, deren Ignorieren Jaspers (1946) der Psychoanalyse vorgeworfen hat, und auch unter Anerkennen des Relationalen, Bezogenen, in der das Selbstverstehen einzig zu finden ist. Die »natürliche« Selbstverständlichkeit als etwas, das dem Menschen möglich ist, aber verloren werden kann (bzw. in der psychischen Entwicklung verstellt ist), realisiert sich psychoanalytisch betrachtet als etwas, das in Beziehungen gefunden wird. Im Anderen, zu dem ich in eine Beziehung eintrete, erkenne ich erst, wer ich als derjenige, der in diese Beziehung eintritt und in dieser gesehen wird, überhaupt bin. Theunissen (1977) hat dies eindrücklich als »Veranderung« bezeichnet. Das heißt nun aber auch, dass die »Meinhaftigkeit«, die in der Psychose verloren wird, als etwas verstanden werden muss, das durch die Erfahrung von Alterität (wieder) gewonnen wird. Die Störung der »Selbstverständlichkeit« wie auch der »Meinhaftigkeit« ist also immer wesentlich eine Störung der Mitwelt, so auch bei Heinz (2014, bes. S. 251; vgl. a. Heinz 2018) im Anschluss an Plessner (1928).
Dabei ist für uns ein Blick auf die (Inter-)Personalität der Psychose und ihrer Behandlung leitend, so auch bei Küchenhoff (2012, S. 26ff), der dazu den Hinweis auf die Arbeit mit dem Fremden gibt. Es geht um eine »Konzeption personaler Identität« unter Beachtung der »Dialektik zwischen Affirmation und Andersheit, zwischen Ausschluss des Fremden und Zusammenwirken mit Fremdem«; a. a. O., S. 30), so dass es letztlich immer auch um ein Ringen um die Fremdverständlichkeit geht, wenn psychotisches Erleben konzeptualisiert und klinisch verstanden werden soll. Küchenhoff (2012, S. 99) meint, in Abwandlung des Diktums psychische Störungen seien Gehirnkrankheiten: »Psychotische Störungen sind Beziehungsstörungen« und das ist zu verstehen als Auseinandersetzung mit Verbindung und Alterität. Maldiney (2018) gebraucht Begriffe der »Transpassibilität« und der »Transpossibilität«, um zu beschreiben, wie in der Erfahrung eines Anderen ein Vermögen zur Wandlung und Entwicklung des Selbst steckt, die in der Psychose nicht möglich bzw. existenziell bedrohlich sind (Grohmann 2019, S. 137ff.).
Daher ist es unser Anliegen, diese relationale und alteritätslogische Perspektive in der Psychoanalyse herauszuarbeiten, der doch, und das nicht nur von Seiten der Psychopathologie, allzu oft der Vorwurf gemacht wird, komplexe psychische und intersubjektive Phänomene und Prozesse auf eine Libidoregression allein zurückzuführen (vgl. z. B. Heinz 2002). Wir wollen uns neben einer Darstellung unterschiedlicher Traditionslinien allerdings in erster Linie an einer Perspektive orientieren, in der psychodynamische Aspekte des Erlebens von Beziehungen und Affekten im Zentrum stehen.
Unsere Darstellung wird dabei vor allem konzeptgeleitet und weniger klinisch sein. Ein konzeptprüfender Blick orientiert sich dabei an einer Rekonstruktion der Überlegungen einzelner Autoren 1 1 Wir werden im Wechsel über die Kapitel das generische Maskulinum und das generische Femininum verwenden. Damit sind jeweils alle Geschlechter gemeint.
sowie an einer Zugangsmöglichkeit zu klinischen Phänomenen. Wir greifen dabei auf Fallvignetten aus jugendpsychiatrischen Behandlungen zurück, die wir jeweils im Lichte einzelner Abschnitte kommentieren. Im Verhältnis von Konzepten und Fall soll beides wechselseitig Anschaulichkeit erfahren und ein Verstehen ermöglichen. Anders als in Jaspers’ Auffassung (  Kap. 2.2.1) soll so eine Verschränkung von klinischem (genetischem) Verstehen (inkl. eines Verstehen der Wahninhalte) und Theoriebildung möglich werden: Gerade die Theorie lässt verstehbar(er) werden, wie sich Seelisches aus Seelischem entwickelt, und zugleich ermöglicht das Fallverstehen die Theoriebildung, nicht in einem erklärenden, naturwissenschaftlichen Sinn, sondern in einer Perspektive darauf (vgl. Zepf 2006, S. 263), dass Theorie allgemein auf den Begriff bringt, wie sich ein Fall und Behandlungsverläufe im Besonderen darstellen (vgl. zur Diskussion von Halluzination bzw. psychotischem Zusammenbruch in der Adoleszenz z. B. Elzer 1992; Günter 2007; Zepf & Zepf 2018, oder Bronstein 2020).
Kap. 2.2.1) soll so eine Verschränkung von klinischem (genetischem) Verstehen (inkl. eines Verstehen der Wahninhalte) und Theoriebildung möglich werden: Gerade die Theorie lässt verstehbar(er) werden, wie sich Seelisches aus Seelischem entwickelt, und zugleich ermöglicht das Fallverstehen die Theoriebildung, nicht in einem erklärenden, naturwissenschaftlichen Sinn, sondern in einer Perspektive darauf (vgl. Zepf 2006, S. 263), dass Theorie allgemein auf den Begriff bringt, wie sich ein Fall und Behandlungsverläufe im Besonderen darstellen (vgl. zur Diskussion von Halluzination bzw. psychotischem Zusammenbruch in der Adoleszenz z. B. Elzer 1992; Günter 2007; Zepf & Zepf 2018, oder Bronstein 2020).
Die vorliegende Arbeit selbst steht in verschiedenen Traditionslinien, so neben der im weitesten Sinn Freud’schen Psychoanalyse (vgl. Storck 2018a), insbesondere in der Linie einer Auffassung psychotischer Störungen in Richtung eines Dilemmas oder einer Bipolarität, wie sie Mentzos (2015, S. 215ff.;  Kap. 3.5.2) oder Benedetti (1983;
Kap. 3.5.2) oder Benedetti (1983;  Kap. 3.5.1) formulieren. Auch das von Küchenhoff (2012) vorgeschlagene psychodynamische Faktorenmodell (
Kap. 3.5.1) formulieren. Auch das von Küchenhoff (2012) vorgeschlagene psychodynamische Faktorenmodell (  Kap. 3.5.9) ist für unsere eigenen Überlegungen leitend. In jüngster Zeit sind ferner einige differenzierte Arbeiten erschienen, die für die vorliegende Arbeit von grundlegender Bedeutung sind: Schwarz et al. (2006), Küchenhoff (2012), Hartwich (2016), Dümpelmann (2018), Matakas (2020) oder die konzeptuellen Grundlagen des Manuals von Lempa, von Haebler und Montag (2017) (Kurzzusammenfassung auf internationaler Ebene zuletzt Weiß 2020). Eine wichtige Brücke, die uns ein Nachdenken über Psychoanalyse und anthropologische/phänomenologische Psychiatrie bzw. Psychopathologie erleichtern, sind die Arbeiten von Fuchs (z. B. 2012) oder Heinz (z. B. 2014).
Kap. 3.5.9) ist für unsere eigenen Überlegungen leitend. In jüngster Zeit sind ferner einige differenzierte Arbeiten erschienen, die für die vorliegende Arbeit von grundlegender Bedeutung sind: Schwarz et al. (2006), Küchenhoff (2012), Hartwich (2016), Dümpelmann (2018), Matakas (2020) oder die konzeptuellen Grundlagen des Manuals von Lempa, von Haebler und Montag (2017) (Kurzzusammenfassung auf internationaler Ebene zuletzt Weiß 2020). Eine wichtige Brücke, die uns ein Nachdenken über Psychoanalyse und anthropologische/phänomenologische Psychiatrie bzw. Psychopathologie erleichtern, sind die Arbeiten von Fuchs (z. B. 2012) oder Heinz (z. B. 2014).
Im Anschluss an einige einleitende Bemerkungen zu unserem Verständnis psychoanalytischer Entwicklungstheorie, psychoanalytischen Verstehens und psychoanalytischer Konzeptbildung sowie zum zugrunde gelegten Blick auf Nosologie, biologische Faktoren, Pharmakotherapie und Psychotherapieforschung (  Kap. 2.1– 2.3) werden wir den dritten Abschnitt den wichtigsten konzeptuellen Traditionslinien widmen; dabei gehen wir auf Freud gesondert ein und widmen uns dann dem Verständnis psychotischer Störungen in einer nordamerikanischen (in seinen Vorläufern: Federn; sowie dann v. a. der Chestnut Lodge-Gruppe, insbesondere bei Searles), britischen (Klein, H. Rosenfeld, Bion, Winnicott) und französischen (Lacan, Racamier, Green) Denkrichtung, bevor wir die Auffassungen weiterer Autoren darstellen (Benedetti, Mentzos, Lang, Resnik, Alanen, Civitarese, De Masi, Küchenhoff sowie die Konzeption der Mentalisierungstheorie). In Kapitel 4 werden wir unter einer kritisch-zusammenfassenden Perspektive die leitenden Aspekte der Entwicklungspsychopathologie und die Psychodynamik der Störung, der auslösenden Situation sowie der Symptomatik darstellen, wie sie in heutiger Perspektive verstanden werden können. Im Anschluss daran widmen wir uns in Kapitel 5 den für die Behandlungstechnik wichtigen Konzepten, mit besonderer Beachtung der Übertragungspsychose, außerdem gehen wir auf Fragen der analytischen Haltung und des Umgangs mit der Gegenübertragung sowie der Deutung ein. Den Abschluss des Kapitels liefern Überlegungen zu Modifikation und Manualisierung analytischer Behandlung psychotischer Störungen. Zwei kürzere Kapitel beschließend den Band: Zunächst gehen wir auf die Bedeutung der Psychoanalyse für die Sozialpsychiatrie ein (
Kap. 2.1– 2.3) werden wir den dritten Abschnitt den wichtigsten konzeptuellen Traditionslinien widmen; dabei gehen wir auf Freud gesondert ein und widmen uns dann dem Verständnis psychotischer Störungen in einer nordamerikanischen (in seinen Vorläufern: Federn; sowie dann v. a. der Chestnut Lodge-Gruppe, insbesondere bei Searles), britischen (Klein, H. Rosenfeld, Bion, Winnicott) und französischen (Lacan, Racamier, Green) Denkrichtung, bevor wir die Auffassungen weiterer Autoren darstellen (Benedetti, Mentzos, Lang, Resnik, Alanen, Civitarese, De Masi, Küchenhoff sowie die Konzeption der Mentalisierungstheorie). In Kapitel 4 werden wir unter einer kritisch-zusammenfassenden Perspektive die leitenden Aspekte der Entwicklungspsychopathologie und die Psychodynamik der Störung, der auslösenden Situation sowie der Symptomatik darstellen, wie sie in heutiger Perspektive verstanden werden können. Im Anschluss daran widmen wir uns in Kapitel 5 den für die Behandlungstechnik wichtigen Konzepten, mit besonderer Beachtung der Übertragungspsychose, außerdem gehen wir auf Fragen der analytischen Haltung und des Umgangs mit der Gegenübertragung sowie der Deutung ein. Den Abschluss des Kapitels liefern Überlegungen zu Modifikation und Manualisierung analytischer Behandlung psychotischer Störungen. Zwei kürzere Kapitel beschließend den Band: Zunächst gehen wir auf die Bedeutung der Psychoanalyse für die Sozialpsychiatrie ein (  Kap. 6), dann diskutieren wir abschließend Horizonte und Grenzen einer Begegnung zwischen Psychoanalyse und Psychopathologie (
Kap. 6), dann diskutieren wir abschließend Horizonte und Grenzen einer Begegnung zwischen Psychoanalyse und Psychopathologie (  Kap. 7).
Kap. 7).
Читать дальше
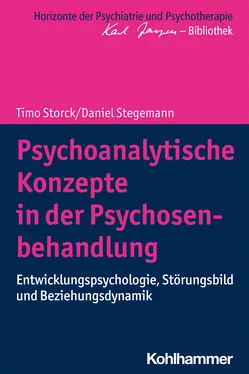
 Kap. 2.2.1) soll so eine Verschränkung von klinischem (genetischem) Verstehen (inkl. eines Verstehen der Wahninhalte) und Theoriebildung möglich werden: Gerade die Theorie lässt verstehbar(er) werden, wie sich Seelisches aus Seelischem entwickelt, und zugleich ermöglicht das Fallverstehen die Theoriebildung, nicht in einem erklärenden, naturwissenschaftlichen Sinn, sondern in einer Perspektive darauf (vgl. Zepf 2006, S. 263), dass Theorie allgemein auf den Begriff bringt, wie sich ein Fall und Behandlungsverläufe im Besonderen darstellen (vgl. zur Diskussion von Halluzination bzw. psychotischem Zusammenbruch in der Adoleszenz z. B. Elzer 1992; Günter 2007; Zepf & Zepf 2018, oder Bronstein 2020).
Kap. 2.2.1) soll so eine Verschränkung von klinischem (genetischem) Verstehen (inkl. eines Verstehen der Wahninhalte) und Theoriebildung möglich werden: Gerade die Theorie lässt verstehbar(er) werden, wie sich Seelisches aus Seelischem entwickelt, und zugleich ermöglicht das Fallverstehen die Theoriebildung, nicht in einem erklärenden, naturwissenschaftlichen Sinn, sondern in einer Perspektive darauf (vgl. Zepf 2006, S. 263), dass Theorie allgemein auf den Begriff bringt, wie sich ein Fall und Behandlungsverläufe im Besonderen darstellen (vgl. zur Diskussion von Halluzination bzw. psychotischem Zusammenbruch in der Adoleszenz z. B. Elzer 1992; Günter 2007; Zepf & Zepf 2018, oder Bronstein 2020).