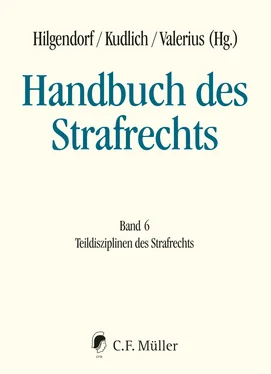129
Doch lässt man bereits eine Überzeugung von einer irgendwie gearteten „Auch-Geeignetheit“ genügen, wird man derlei Erwägungen als nicht fundierte Behauptungen zurückweisen, vor allem die epidemiologische Vergleichbarkeit von Ländern ohne sanktionsbewehrten Verboten wegen abweichender sozialer Rahmenbedingungen verneinen. Selbst wenn man davon ausginge, dass diese „Verneinung“ kriminologisch bzw. soziologisch schlicht unhaltbar ist, wird die Überzeugung, dass die Sanktionsbewehrung „auch-geeignet“ ist, weiterhin ausreichen. Hat man die Geeignetheit allerdings hinter sich, befindet man sich auf der Ebene der Erforderlichkeitwieder auf „sicheren Gefilden“, da man sich nun im Anschluss schlicht auf seine Einschätzungsprärogative stützen und vertreten kann, dass in Relation zur Sanktionsbewehrung kein „gleich effektives“ Mittel zur Verfügung stehe. Das Auswahlermessen des Gesetzgebers betrifft dann die geltende Rechtslage und (scheinbar weit entfernte) Alternativen, die man kaum abschätzen kann. Mit der Vermutung, andere (nicht exemplifizierte) Konzepte könnten die Verbreitung nicht ebenso gut verhindern, wird der aktuelle Zustand legitimiert. Das ist schon in Anbetracht des Umstands, dass verschiedene Alternativen in Betracht gezogen werden müssen, problematisch, aber vor allem verfassungsrechtsmethodisch eine Bankrotterklärung, da man auf diese Weise jedes bereits existente Gesetz legitimieren kann.
3. Betäubungsmittelrecht de lege ferenda
130
Die Tatsache, dass die Argumente gegen eine Legalisierung den derzeitigen Rechtszustand nicht zugleich bekräftigen, müsste Anlass genug sein, die Überprüfung, ob gleich geeignete, aber weniger einschneidende Mittel existierten, zuzulassen, mithin das „Sozialexperiment“ des Verzichts auf das Strafrecht. Damit würde man nicht nur dem Bürger ein Stück Freiheit zurückgeben und Vertrauen in die Rechtsgemeinschaft signalisieren, sondern könnte bereits nach kurzer Zeit auf (evidenzbasierte) Forschungzurückgreifen. Zudem sind gesetzgeberische Schritte nicht unumkehrbar. Eine Teillegalisierung bzw. Entkriminalisierung stellt keine Einbahnstraße dar; verspielt der Bürger das Vertrauen, besteht wiederum die Möglichkeit das Verbot erneut zu erlassen. Dass sich der Einfluss des gesetzgeberischen Eingriffs wahrscheinlich erst langfristig bemerkbar machen wird, spricht nicht gegen derartige Vorstöße, sondern macht deutlich, dass kurzfristig ohnehin keine erheblichen Gefahren für die Gesellschaft bzw. Rechtsgemeinschaft zu prognostizieren sind.
131
Die Palette denkbarer Neukonzeptionen (Entkriminalisierung, Legalisierung) kann und muss an dieser Stelle auch nicht detailliert dargestellt werden;[345] der Gesetzgeber sollte sich jedoch im Klaren sein, dass zahlreiche Baustellen der Drogenpolitik angegangen werden können, ohne das geltende System in Frage zu stellen. Neben einer Implementierung weiterer harm-reduction-Maßnahmen (wie z.B. dem drug-checking[346]), sollte über eine deutlichere Abkoppelung der medizinischen Versorgungnachgedacht, ein garantierter Zugang zur Notfallmedizin, insbesondere Naloxon-Kits[347] gewährleistet und auf verbesserte Bedingungen für Drogenabhängige in der Hafthingewirkt werden.[348] In Drogennotfällen sollte sich die Strafandrohung auf diejenige, die aus der Verletzung der Hilfspflicht resultiert (§ 323c StGB, ggf. §§ 212, 13 StGB), beschränken, mithin sollte der gemeinsame Konsument nicht aus Angst vor Aufdeckung des eigenen Drogenbesitzes davon absehen, Menschenleben zu retten.[349]
132
Auch was den Handel angeht, besteht, wie sich aus den Ausführungen bei Rn. 60 ff.ergeben haben dürfte, dringender Handlungsbedarf. Die mit der ausufernden Auslegung des Handeltreibens einhergehenden dogmatischen Friktionen erfordern eine gesetzgeberische Klarstellung. Die Qualifikationstatbestände müssen neu geordnet, die Versuchs- und Fahrlässigkeitsstrafbarkeit auf wenige (dogmatisch sinnvolle) Fälle beschränkt werden.[350] Darüber hinaus oder alternativ ist über spezifische Strafzumessungsvorschriften nachzudenken, welche Strafrahmenverschiebungen für in der Rechtsprechung bereits anerkannte Konstellationen beinhalten, etwa beim Handeln als Kurier, bei einem geringen Gewinn oder bei der Eigenschaft als „social supplier“.[351] Den Anfang könnte man mit der Einfügung einer tätigen Reue Vorschrift (in einem neuen § 30c BtMG-E) machen, welcher den „Rücktritt“ vom Handeltreiben einerseits, die besondere Situation des agent provocateur bzw. Lockspitzels andererseits angemessen erfasst.[352]
E. Strafprozessuales
I. Strafprozessrecht und „Giftsachen“
133
Der illegale Betäubungsmittelumsatz gehört zu den wichtigsten Umsatzquellen und Betätigungsfeldern der Organisierten Kriminalität. Typisches Charakteristikum schwerer Betäubungsmittelkriminalität ist das gebietsübergreifende Operieren von Rauschgiftverteilerringen, welche rechtliche Lücken und tatsächliche Defizite der jeweiligen Orte zu Profitzwecken planend einsetzen und sich zu eigen machen. Das Zerschlagen derartiger Vereinigungen und Banden erfordert die volle Bandbreite an strafprozessualem Instrumentarium, welches das Verfahrensrecht zur Verfügung stellt; von längerfristigen Observationen über TKÜ-Maßnahmen bis hin zum Einsatz verdeckter Ermittler. Zahlreiche, für sonstige Kriminalitätsfelder paradigmatische Entscheidungen zum Strafprozessrecht (etwa diejenige zur rechtsstaatswidrigen Tatprovokation[353] oder zu den Anforderungen an den Tatverdacht bei Hausdurchsuchungen[354]) ergingen im Kontext der Verwirklichung betäubungsmittelstrafrechtlicher Tatbestände. Und schließlich ergeben sich aus der Struktur der Betäubungsmitteldelikte Besonderheiten im Hinblick auf den prozessual zu ermittelnden Stoff (frühe Tatbestandsvollendung, zahlreiche Tathandlungen, mehrere Beteiligte ohne Haupttäter etc.); freilich würde aber eine umfassende Darstellung strafprozessualer Spezifika in „Giftsachen“den vorliegenden Rahmen sprengen[355] und wäre auch im Übrigen wenig ergiebig, da die Phänomenologie eines Kriminalitätsgebiets die prozessualen Maßstäbe – etwa die Anforderungen, die an einen Tatverdacht bei Bagatelldelikten wie dem Erwerb von Betäubungsmitteln zum Eigenkonsum zu stellen sind – gänzlich unberührt lässt. Insofern wird im Folgenden auf eine lose Zusammenfassung strafprozessualer Leitlinien, die im Kontext des Betäubungsmittelrechts entstanden sind, verzichtet und stattdessen ausschließlich die, allein den Tatbeständen des Betäubungsmittelstrafrechts vorbehaltene, strafprozessuale Einstellungsvorschrift des § 31a BtMG skizziert.
II. Die besondere Einstellungsvorschrift des § 31a BtMG
134
§ 31a Abs. 1 BtMG ergänzt die Einstellungsvorschriften der §§ 153 ff. StPO bzw. verdrängt diese sogar in bestimmten Fällen als lex specialis. Die Vorschrift lässt sich spätestens seit dem Cannabis-Beschlussdes BVerfG ( Rn. 107) als verfassungsrechtliche Krücke des Betäubungsmittelstrafrechts bezeichnen, da das BVerfG die Aufrechterhaltung des generellen Verbots des Umgangs mit kleineren Mengen zum „Eigenbedarf“ gerade mit der Möglichkeit begründet hat, das Verfahren bei Bagatellen einzustellen. Doch konnte die Vorschrift diese Funktion bis heute kaum zufriedenstellend erfüllen, was auf ihre Ausgestaltung als Opportunitätsvorschrift zurückgeht; so wird auf die Einstellung wegen geringer Mengen in der Praxis (in einigen Ländern fast) nur im Falle des Erwerbs und Besitzes von Cannabis zurückgegriffen, obwohl der Wortlaut sich keinesfalls auf diese Droge (oder „weiche“ Drogen) beschränkt, vielmehr auf eine Betäubungsmittel und einen großen Tathandlungskatalog (u.a. auch auf die Einfuhr und den Anbau) Bezug nimmt.
Читать дальше