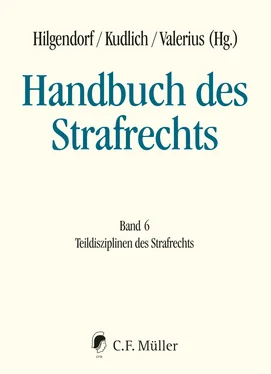§ 55 Arzneimittelstrafrecht
A. Einführung 1 – 6
I. Arzneimittelrecht als Verbraucherschutzrecht 1
II. Praktische Bedeutung des Arzneimittelstrafrechts 2 – 4
III. Arzneimittelrecht als „Auffangbecken“ für unliebsame Substanzen? 5, 6
B. Grundlagen 7 – 24
I. Systematik der Strafvorschriften 7, 8
II. Tatbestandsstrukturen, insbesondere Blanketttechnik 9 – 12
1. Binnenverweise und Normspaltung 10
2. Außenverweise und Gewaltenteilung, Art. 20 Abs. 3 GG 11, 12
III. Grundbegriffe des Arzneimittel(straf)rechts 13 – 22
1. Arzneimittel, § 2 AMG 14 – 21
a) Definition im Einzelnen 15 – 20
aa) Präsentationsarzneimittel 18
bb) Funktionsarzneimittel 19, 20
b) Arzneimitteldefinition und Arzneimittelstrafrecht 21
2. Tathandlungen: Inverkehrbringen und Abgabe 22
IV. (Europäische) Rechtsquellen des Arzneimittel(straf)rechts 23, 24
C. Die Strafvorschriften der §§ 95 ff. AMG im Überblick 25 – 27
I. Statistisches 25
II. Aufbau der Strafvorschriften 26, 27
Ausgewählte Literatur
A. Einführung
I. Arzneimittelrecht als Verbraucherschutzrecht
1
Das deutsche Arzneimittelrecht soll die ordnungsgemäße Arzneimittelversorgungvon Menschen und Tieren sichern und ist damit in erster Linie Verbraucherschutzrecht(vgl. → BT Bd. 6: Mustafa Oğlakcıoğlu , Betäubungsmittelstrafrecht, § 54 Rn. 1). Schutzgut der arzneimittelstrafrechtlichen Vorschriften ist folglich der „Arzneimittelmarkt“, was zu einem reflexhaften Schutz von Leib und Leben und des Vermögens führt. Zudem beziehen sich zahlreiche Vorschriften auch auf Tiere, sodass die Vorschriften insofern auch dem Tierschutz dienen. Dadurch, dass der Gesetzgeber fast jeden Verstoß gegen Verhaltens- und Verbotsvorschriften des AMG am „dicken Ende“ der §§ 95 ff. AMG mit Strafe bewehrt oder zumindest als Ordnungswidrigkeit geahndet wissen will, ist Arzneimittelrecht eigentlich immer auch „Arzneimittelstrafrecht“. Die verfassungsrechtlich zum Teil als problematisch erachtete Blanketttechnik[1] wird in den §§ 95, 96 AMG in all ihren Facetten (Binnenverweise, dynamische Verweise auf EU-Verordnungen etc., vgl. noch Rn. 9 ff.m.w.N.) zelebriert.[2] Den verfassungsrechtlichen Bedenken, welche vor allem den dynamischen Verweis in § 6 AMG betrafen, begegnete man unter expliziter Bezugnahme in der Gesetzesbegründung auf die bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung mit dem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (AMVSÄndG)[3], indem man die bisherige Rechtsgrundlage für Verbotsverordnungen um klare strafbewehrte Verbotsnormen ergänzte.
II. Praktische Bedeutung des Arzneimittelstrafrechts
2
Trotz des umfangreichen Straftatenkatalogs lässt sich das Arzneimittelrecht – jedenfalls inzwischen – schon im Hinblick auf die geringe praktische Bedeutung der (zahlreichen) Strafvorschriften nicht – oder: jedenfalls nicht mehr – als strafrechtliche Materiebezeichnen. Dies lässt sich schlicht auf den Gegenstand des Gesetzes zurückführen. Das AMG regelt schließlich den Umgang mit Arzneimitteln, die in jedem Fall – soweit die Arzneimitteleigenschaft bejaht werden kann – nicht derart gefährlich sein dürften, dass ein umfassendes Umgangsverbot gerechtfertigt sein könnte. Der Verdacht „kriminellen Handelns“ rührt bei Arzneimitteln kraft der gesetzlichen Ausgestaltung (Regulierung der Herstellung und des Vertriebs) nicht bereits daher, dass man mit dem fraglichen Stoff umgeht. Da es sich auch um echtes Verbraucherschutzstrafrecht handelt, wird der Endkonsumentselbst aus dem Visier der strafrechtlichen Verfolgung genommen.
3
Hinzu tritt, dass Ermittlungsverfahrenerst in denjenigen Fällen angestoßen werden, in denen das Anzeigerisiko durch die Beeinträchtigung von Individualinteressen ansteigt und bei denen das Arzneimittelstrafrecht kontextual verwirklicht ist (mithin als Vorbereitungstat oder Durchgangsstadium für einen anderen Tatbestand fungiert, insbesondere Betrug, Untreue, aber auch Körperverletzung).[4] Als Vergehen sind die §§ 95 ff. AMG einer flexiblen Handhabung durch die Staatsanwaltschaft ( §§ 153, 153a StPO) zugänglich, zumal nicht selten polizeipräventive und berufsrechtliche Maßnahmen als „Sanktion“ ausreichen. Entsprechend dünn besiedelt ist die Rechtsprechung zum Arzneimittelstrafrecht (was zumindest ihre Auswertung vereinfacht): Diverse Rechtsprechungsdatenbanken zeigen bei Eingabe der Grundstrafnorm (§ 95 AMG) in die Suchmaske für den gesamten Zeitraum der Erfassung zwischen 50–100 Entscheidungen an, für den Zeitraum zwischen 2014–2017 sind es zwischen 15–30 Treffer.
4
Viele Auslegungsfragen der Arzneimittelmarktregulierung (man denke an die Preisbindungbei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln,[5] die Einordnung der Zulassungals produkt- oder personenbezogen[6] oder an die Grenzen und Reichweite des Re- und Parallelimports[7]) betreffen ausschließlich den legalen Arzneimittelverkehr. Über diese wird in zivil- und verwaltungsrechtlichen Verfahren gestritten, weswegen sie – mögen sie aus gesundheitspolitischer Perspektive paradigmatisch sein – für das Strafrecht keine Rolle spielen. Die dargelegten Streitfragen werden von „Betroffenen“, also denjenigen ausgefochten, die ihr Verhalten idealtypisch an den Vorschriften des AMG ausrichten (Pharmazeuten, Apotheker etc.). Daher werden gerichtliche Entscheidungen meist auch durch ein „transparentes Verhalten“ (Antragsstellung) herausgefordert.[8]
III. Arzneimittelrecht als „Auffangbecken“ für unliebsame Substanzen?
5
Überhaupt hat das Arzneimittelrecht bis dato strafrechtlich stets dann eine Rolle gespielt, wo es gerade keine Anwendung hätte finden dürfen, namentlich im Bereich der Rauschgiftkriminalitätund des Dopings. So wurde bis vor kurzem noch der Funktionsarzneimittelbegriff – im wahrsten Sinne des Wortes – zur Erfassung neuer psychoaktiver Substanzen funktionalisiert, die mangels Aufnahme in die Anlagen des BtMG nicht als Betäubungsmittel klassifiziert werden konnten (→ BT Bd. 6: Oğlakcıoğlu , § 54 Rn. 5 ff.). Die meisten höchstrichterlichen Urteile zum Arzneimittelstrafrecht haben Sachverhalte zum Gegenstand, in denen es eben um diese Auffangfunktion des Arzneimittelbegriffs innerhalb der Rauschgiftkriminalitätsbekämpfung geht.[9] Der EuGH hat diesem Vorgehen mit einer Entscheidung vom 10. Juli 2014[10] einen Riegel vorgeschoben, worauf der Gesetzgeber mit dem Erlass des Neue-Psychoaktive-Stoffe-Gesetzes(NpSG) reagierte.[11] Präparaten, die der Leistungssteigerung dienen, wurde nach einem kurzen Intermezzo der Dopingstrafbarkeit über die Vorschriften des AMG (§ 95 Abs. 1 Nr. 6a AMG a.F.)[12] ein eigenständiges Regelwerk, das Antidoping-Gesetzgewidmet.[13]
6
Damit wurden zwei praktisch bedeutsame Substanzklassen (Doping und nicht unter die Anlagen des BtMG fallendes Rauschgift) dem AMG endgültig und unmissverständlich entzogen und in andere Gesetze überführt. Noch hat sich dieses „Outsourcing“ des Arzneimittelrechts(wegen der ohnehin geringen Bedeutung des AMG in der PKS) kaum bemerkbar gemacht, doch lässt sich für die Zukunft eine weitere Abnahme der praktischen Bedeutung des Arzneimittelstrafrechts prognostizieren. Daran dürfte auch das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (AMVSÄndG, Rn. 1) nicht viel ändern, da die Neufassung des § 6 AMG, auf den § 95 Abs. 1 Nr. 2 AMG Bezug nimmt, vor allem dazu diente, den bundesverfassungsgerichtlichen Anforderungen an die Bestimmtheit einer Strafnorm gerecht zu werden; die Vorschrift hatte aber vor dieser Änderung aus strafrechtlicher Perspektive untergeordnete Bedeutung. Im Folgenden beschränken sich die Ausführungen daher auch auf eine Darstellung der Systematik, eines Überblicks hinsichtlich der zentralen Bezugsnormen und der zentralen Begriffe des Arzneimittel(straf)rechts.
Читать дальше