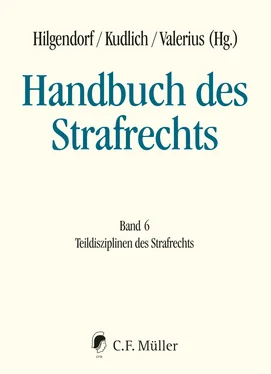107
In seinem Beschluss vom 9. März 1994[268] gibt das BVerfG eine umfassende Stellungnahme zu den Rechtsgütern (und zur Frage des „Rechts auf Rausch“) ab, wobei es die in diesem Grundsatzbeschluss gemachten Ausführungen in weiteren Kammerbeschlüssen (hauptsächlich im Bereich des illegalen Umgangs mit Cannabis) bestätigt.[269] Die Besonderheit am Cannabis-Beschluss des BVerfG liegt darin, dass das Gericht nicht nur auf das bereits bekannte zweigliedrige Schutzkonzept eingeht, sondern auch neu konzipierte (Universal-)Rechtsgüter bzw. Gemeinschaftsbelangeals Legimitationsbasis für die Strafvorschriften des BtMG formuliert,[270] u.a. das von „illegalen Drogen nicht beeinträchtigte soziale Zusammenleben“, den Jugendschutz, die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und die Gewährleistung der internationalen Zusammenarbeit bei der Suchtstoffkontrolle.
108
Das zweispurige Konzept der Rechtsprechung – Individual- und Universalrechtsgüterschutz – wird auch „zweispurig“ kritisiert:[271] Bei den Universalrechtsgütern der „Volksgesundheit“ bzw. „des nicht von Drogen beeinträchtigten, sozialen Zusammenlebens“ wird bereits deren Existenzberechtigung angezweifelt und diskutiert, ob sie einem (systemtranszendenten) Rechtsgutsbegriffüberhaupt gerecht bzw. als Legitimationsbasis für die Strafbarkeitsvorverlagerung herangezogen werden können.[272]
109
So wird dem Rechtsgut der Volksgesundheit vorgeworfen, dass es keinen eigenständigen Gehalthabe.[273] Im Betäubungsmittelstrafrecht werde die Summe der einzelnen Individualrechtsgüter zu einem Kollektivrechtsgut zusammengefasst[274] und sei daher als „Scheinrechtsgut zu entlarven“. Dies stelle eine unzulässige „ Hypostasierung“[275] dar, da man ein konkretes Gut allgemein gehaltenen, undurchsichtigen Universalrechtsgütern unterstelle, obwohl der Tatbestand ihn als real existierender Bezugspunkt – „klassenlogisch näher“[276] – benennen könnte. Ein eingetretener Schaden für die Volksgesundheit sei nämlich niemals feststellbar, geschweige denn im Einzelfall messbar. Anders bei den Rechtsgütern Leben und körperliche Unversehrtheit: Als solches unbestritten anerkannt,[277] geht es hier nur um die Frage, ob das BtMG die körperliche Unversehrtheit des Einzelnen schützen darf , oder – zumindest partiell – nicht als „aufgedrängter, staatlicher Schutz vor Selbstschädigung“ angesehen werden müsste (meist unter dem Stichwort des illegitimen Paternalismusdiskutiert, was – ähnlich wie im Rahmen der Rechtsgutsdefinition selbst – wiederum zur Folge hat, dass man in den Wirren einer Begriffsbestimmung die eigentliche Frage aus dem Blick verliert).
III. Die maßstabsschwächende Sonderdogmatik im Verfassungsrecht
110
„Transferiert“ man die Rechtsgutsdoktrin und die kritischen Einwände auf das verfassungsrechtliche Rechtmäßigkeitsschema, wird deutlich, dass sie unterschiedliche Ebenen der Verhältnismäßigkeitsprüfung betreffen, was zur Folge hat, dass die innerhalb der Rechtsgutsdoktrin konzentrierte Kritik „zerstreut“ wird und ihre Wucht verliert.
111
Zunächst lassen sich – ausgehend von einem großzügigen Maßstab – alle Rechtsgüter als „Gemeinschaftsbelange“ verstehen, die sich unter den verfassungsrechtlichen Begriff des legitimen Zwecks fassen. Auf dieser Ebene hat die Verfassungsrechtsdogmatik kaum einschränkende Wirkung, weil die grundsätzliche Schutzbedürftigkeit von Gemeinschaftsbelangenkaum in Frage gestellt wird.
112
Die objektivrechtliche Funktion eines Grundrechts (also die Funktion als „Schutzbelang“) kommt jedenfalls dann nicht zum Tragen, wo der Wesensgehalteines grundrechtlichen Verfassungsguts, auf das der Grundrechtsberechtigte verzichtenmöchte, nicht berührt wird.[278] Bei den meisten Drogen, deren einmaliger Konsum nicht lebensgefährlich ist (mangels Toxizität, vgl. bereits Rn. 35), kann damit aus dem verfassungsrechtlichen Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG verankerten objektiven Lebensschutzkeine grundrechtliche Schutzpflicht hergeleitet werden.[279] Hinsichtlich der körperlichen Unversehrtheitdagegen könnte man – eine niedrige Schwelle des Wesensgehalts zugrunde legend – davon ausgehen, dass das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen zurücktritt, wenn die körperliche Unversehrtheit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auf Dauer beeinträchtigt werden könnte.[280] Dies ist auch der Grund, warum im Rahmen der kriminalpolitischen Erwägungen derart intensiv über die Auswirkungen des Cannabiskonsumsund zur Wahrscheinlichkeit dauernder Schäden bei dessen Konsum diskutiert wird (hierzu Rn. 117 ff.). Dabei dreht sich die Lehre vom Wesensgehalt auch im Kreis, da die Frage, ob der Wesensgehalt des Grundrechts berührt ist, wiederum vom Grundrechtsträger abhängt (insbesondere der Art und Weise wie und was er konsumiert, den Mengen, dem Reinheitsgrad etc.).[281]
113
Der Gefährlichkeitsprognosekann man allerdings „entgehen“, wenn man in der freien Verfügbarkeit einer Substanz stets die Gefahr sieht, dass sie in die Hände eines unverantwortlich agierenden Dritten gelangen könnte. Dementsprechend wird – um der paternalistischen Ausgestaltung etwas die Schärfe zu nehmen – häufig darauf hingewiesen, dass der Erwerb und Besitz von Substanzen – mögen diese auch zum Eigenkonsum bestimmt sein – stets die Gefahr mit sich brächte, dass der Stoff in die Hände einer unverantwortlichen Persongerät. Mit solch einer Argumentation könnte jedoch jede gefährliche Substanz und jeder gefährliche Gegenstand ohne Einschränkungen verboten werden. Umso erstaunlicher ist es, wenn Drogen in diesem Zusammenhang mit Waffen verglichen werden[282] und damit postuliert wird, das Verbot eine Waffe zu besitzen, verfolge hauptsächlich den Zweck, dass unverantwortlich agierende Personen nicht in den Besitz der Waffe gelangen sollen, statt potentielle Verletzungs- und Tötungshandlungen zu verhindern.
2. Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit im Einzelnen
114
Diese Entmachtung eines systemkritischen Rechtsgutsbegriffs auf der Ebene des legitimen Zwecks setzt sich auf den weiteren Stufen der Verhältnismäßigkeitsprüfung weiter fort. Im (insgesamt noch unausgegorenen) „ Strafverfassungsrecht“[283] wird die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers in den Mittelpunkt gerückt, die den Eingriff (Verbot von Substanzen) weitestgehend gegen jegliche Alternativen und vorgebrachten Bedenken immunisiert. So kann die Kritik gegen die mangelnde Gefährdung der Gemeinschaftsbelange kaum Berücksichtigung finden, wenn der Gesetzgeber vom Gegenteil überzeugt ist (besserer Jugendschutz, Gefährlichkeit eines bestimmten Stoffs).[284] Das ist prekär, weil sich dann keine Maßstäbe für die Überzeugung entwickeln können und die „Überzeugung“ auch nicht verteidigt werden muss.
115
Gerade die jüngere Strafgesetzgebung hat gezeigt, dass man von einem sehr großzügigen Beurteilungsspielraum der Legislative auszugehen scheint, was zur Verschiebung der Begründungslastenführt, wenn der Eingriff in Freiheitsrechte postuliert wird. Besonders deutlich wird dies, wenn in verfassungsrechtlichen Abhandlungen die Legitimität bzw. verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer Entkriminalisierung des Cannabiskonsumsauf den Prüfstein gelegt wird (!), und man nach Bejahung dieser Frage (Legalisierung von Cannabis verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig) dazu übergeht, die rechtspolitische Zweckmäßigkeit der Legalisierung zur Diskussion zu stellen.[285] Zwar bedeutet die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Legalisierung nicht zwingend eine Verfassungswidrigkeit der Kriminalisierung bzw. des Verbots. Aber abgesehen davon, dass man die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Eingriffs (also des Verbots) prüfen müsste, spricht doch viel für eine Verfassungswidrigkeit des Verbots, wenn im Rahmen der „umgekehrten Prüfung“ (die sich an der lex lata orientiert) alle Argumente für und wider abgehandelt wurden. Die geschilderte Umkehr der Begründungslast lässt sich anhand einzelner Belange, die das Verbot zu schützen bezweckt, anschaulich demonstrieren:
Читать дальше