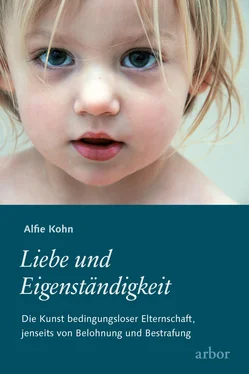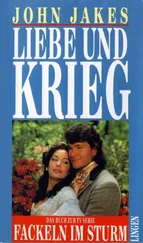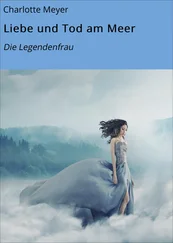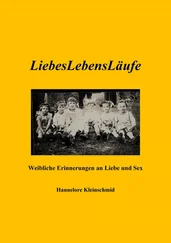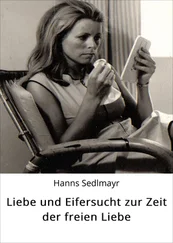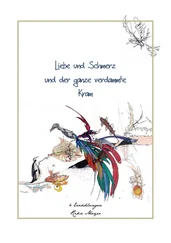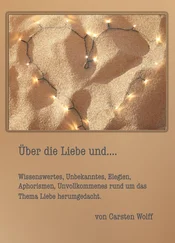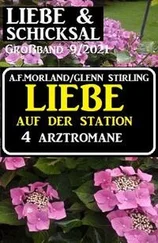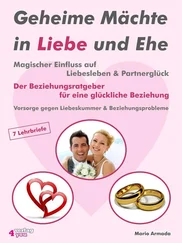Meiner Ansicht nach sind beide Positionen problematisch. Vor ein paar Jahren habe ich mich recht umfassend mit der vorliegenden Forschung beschäftigt 17und etwas überrascht festgestellt, dass ein höheres Selbstwertgefühl nicht immer von besseren Ergebnissen begleitet ist, und selbst wenn dies der Fall ist, bedeutet dies nicht, dass es die besseren Ergebnisse hervorgerufen hätte.
Allerdings bringt mich das nicht in das Feld derjenigen, die vom ganzen Konzept des Selbstwertgefühls nichts halten. Manche sind dieser Ansicht, weil sie glauben, wenn Kinder im Grunde mit sich selbst zufrieden seien, hätten sie keine Motivation, irgendetwas zu leisten. Wenn ihre Aufmerksamkeit auf den Wert dessen, wer sie sind, statt auf das, was sie tun, gerichtet sei, würden sie wahrscheinlich nicht viel leisten. Man müsse unzufrieden sein, um etwas zu lernen oder herzustellen. Wer es zu etwas bringen will, muss leiden.
Diese Behauptung beruht auf mehreren falschen Prämissen, die ich in Kapitel 5 näher erläutern werde. Im Moment möchte ich aber nur auf Folgendes aufmerksam machen: Zwar behaupten viele Kritiker, ein höheres Selbstwertgefühl habe keinerlei positive Auswirkungen, jedoch liegt der Kern ihrer Argumentation darin, dass Selbstwertgefühl einfach etwas Schlechtes sei, unabhängig von seiner Wirkung. Für sie ist der schlimmste Begriff, den sie sich vorstellen können, Wohlfühlpädagogik, was andeutet, dass sie offenbar glauben, mit sich selbst zufrieden zu sein habe etwas zutiefst Suspektes an sich. Knapp unter der Oberfläche ihrer Polemik lauert die Angst, Kinder könnten sich zufrieden fühlen, ohne sich das Recht verdient zu haben, so zu empfinden. Hier haben wir die Welt der Tatsachen verlassen und sind durch die Hintertür in das Reich der moralistischen Grundüberzeugungen eingetreten. Dies ist ein Ort puritanischer Inbrunst, wo Menschen nur im Schweiße ihres Angesichts essen dürfen und Kinder keine gute Meinung von sich selbst haben dürfen, wenn sie nicht eine greifbare Leistung vorweisen können.
Mit anderen Worten, die Konservativen richten sich eigentlich gegen ein bedingungsloses Selbstwertgefühl. Jedoch erkennen Forscher gerade, dass eben diese Dimension entscheidend ist, um die Lebensqualität von Menschen einschätzen zu können. Wenn wir uns für die psychische Gesundheit eines Menschen interessieren, ist die entscheidende Frage vielleicht nicht die, wie viel Selbstwertgefühl er besitzt. Vielmehr kommt es darauf an, wie stark sein Selbstwertgefühl je nachdem, was in seinem Leben geschieht – etwa wie erfolgreich er ist oder was andere von ihm denken –, schwankt. Das wirkliche Problem besteht gar nicht darin, dass jemand ein zu geringes Selbstwertgefühl hat („Ich hab das Gefühl, nicht viel wert zu sein“), sondern dass sein Selbstwertgefühl zu sehr an Bedingungen geknüpft ist („Ich hab nur dann das Gefühl, etwas wert zu sein, wenn …“). 18
Edward Deci und Richard Ryan, zwei in der Forschung tätige Psychologen, die die Wichtigkeit dieser Unterscheidung betont haben, räumen ein, dass selbst Menschen mit etwas, was dem „wahren“ – oder bedingungslosen – Selbstwertgefühl nahe kommt, „sich wahrscheinlich freuen, wenn ihnen etwas gelingt, und enttäuscht sind, wenn etwas misslingt. Doch ihr Gefühl des eigenen Werts würde nicht in Abhängigkeit von ihren Leistungen schwanken, daher würden sie sich nicht als etwas Besseres oder als überlegen fühlen, wenn sie Erfolg haben, oder deprimiert und wertlos, wenn sie versagen.“ 19
Diese extreme Schwankung ist nur eine der Folgen davon, das eigene Selbstwertgefühl darauf zu stützen, ob eine Reihe von Erwartungen – seien es die anderer Leute oder die eigenen – erfüllt werden oder nicht. Eine ganz aktuelle Studie kommt zu dem Ergebnis, dass ein an Bedingungen geknüpftes Selbstwertgefühl bei Hochschulstudenten mit „einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, zu trinken, um soziale Anerkennung zu erreichen und soziale Ausgrenzung zu vermeiden“, verbunden ist. Andere Forschungsarbeiten stellen einen Zusammenhang zu Ängstlichkeit, Feindseligkeit und einer defensiven Grundhaltung her. Solche Menschen neigen dazu, um sich zu schlagen, wenn ihr Selbstwertgefühl bedroht ist, was regelmäßig geschehen kann. Ebenso kann es sein, dass sie an Depressionen leiden und sich in selbstzerstörerisches Verhalten flüchten. Wenn sie sich nur wohlfühlen, wenn sie glauben, gut auszusehen, können sie anfällig für Essstörungen sein. 20
Im Gegensatz dazu stellt sich heraus, dass ein bedingungsloses Selbstwertgefühl – eben das, worüber man sich in manchen Kreisen lustig macht – das beste Ziel ist, das man anstreben kann. 21Menschen, die in der Regel nicht glauben, ihr Wert hinge von ihrer Leistung ab, neigen eher dazu, Misserfolge nur als vorübergehende Rückschläge anzusehen, als Probleme, die man lösen kann. Auch neigen sie offenbar weniger zu Ängsten oder Depressionen. 22Und noch etwas: Sie neigen auch weniger dazu, sich Sorgen um das Thema Selbstwertgefühl zu machen! Viel Zeit mit der Überlegung zu verbringen, wie gut man wohl ist, oder mit dem gezielten Versuch, sein Selbstwertgefühl zu steigern, funktioniert meist nicht besonders gut und ist auch ein schlechtes Zeichen. Es weist auf andere Probleme hin – speziell darauf, dass das Selbstwertgefühl verletzlich und an Bedingungen geknüpft ist. „Ein Paradox des Selbstwertgefühls: Wenn man es braucht, hat man es nicht, und wenn man es hat, braucht man es nicht.“ 23
Was bringt Menschen dazu, diesen unglücklichen Zustand eines an Bedingungen geknüpften Selbstwertgefühls zu entwickeln? Welche Umstände führen dazu, dass sie sich selbst nur für gut halten, wenn…? Eine wahrscheinliche Ursache ist Wettbewerb: eine Situation, in der jemand nur dann Erfolg haben kann, wenn andere versagen, und wo der Ruhm nur für den Sieger reserviert wird. Das ist eine ausgezeichnete Methode, um den Glauben von Menschen an sich selbst zu untergraben und zu lehren, man sei nur dann etwas wert, wenn man triumphiert. 24Es gibt auch Grund zu der Annahme, dass ein an Bedingungen geknüpftes Selbstwertgefühl die Folge eines Erziehungsstils sein kann, bei dem Kinder zu stark kontrolliert werden, wie ich im folgenden Kapitel erläutern werde.
Vor allem jedoch scheint ein an Bedingungen geknüpftes Selbstwertgefühl daher zu rühren, dass man von anderen nur unter gewissen Bedingungen anerkannt wird. Dies führt uns wieder dahin zurück, womit wir angefangen haben: Wenn Kinder das Gefühl haben, von ihren Eltern nur unter bestimmten Bedingungen geliebt zu werden – ein Gefühl, das typischerweise durch die Verwendung von Methoden des Liebesentzugs und der positiven Verstärkung hervorgerufen wird –, fällt es ihnen sehr schwer, sich selbst anzunehmen. Und von da an geht alles bergab.
Neulich kam meine Frau nachmittags mit unseren Kindern von einem Ausflug in den Park zurück. Sie schüttelte den Kopf und sprudelte hervor: „Ich kann es kaum fassen, wie manche Eltern mit ihren Kindern sprechen – so erniedrigend und feindselig. Warum haben sie überhaupt Kinder?“ Da ich selbst auch schon mehr als einmal etwas Ähnliches erlebt hatte, beschloss ich, etwas von dem, was wir in der Stadt hörten und sahen, aufzuschreiben. Innerhalb weniger Tage hatte ich unter anderem folgende Beobachtungen notiert:
• Ein Kleinkind wurde scharf zurechtgewiesen, weil es im Kinderbereich der öffentlichen Bücherei mit einem Stoffbär geworfen hatte, obwohl niemand sonst in der Nähe war.
• Ein Junge, der im Supermarkt gefragt hatte, ob er ein Plätzchen haben dürfte, bemerkte, dass ein anderer kleiner Junge eins aß. Als er seine Mutter darauf hinwies, sagte sie zu ihm: „Nun, das liegt sicher daran, dass er aufs Töpfchen geht.“
• Ein kleiner Junge stieß einen lauten Freudenschrei aus, als er auf dem Spielplatz von einer Schaukel sprang. Daraufhin zischte seine Mutter: „Hör sofort mit dem Blödsinn auf! Das Schaukeln hat sich für heute erledigt. Noch einmal, und du bekommst eine Auszeit.“
Читать дальше